Ultraschall Röntgen CT MRT MRT, CT – was untersucht man wie
Warum macht der Arzt beim Verdacht auf Knochenbruch eine Röntgenaufnahme? Ginge da nicht auch ein Ultraschall oder ein MRT? Lesen Sie, was welche Untersuchung leisten kann und worauf Sie als Patientin oder Patient achten sollten.

Ultraschalluntersuchung
Diese Untersuchung wird kurz Ultraschall genannt. Andere Bezeichnungen sind Sonografie oder Echografie.
Ärztinnen und Ärzte nutzen den Ultraschall, um Organe wie zum Beispiel Leber, Herz, Nieren und die Schilddrüse zu betrachten. Auch bei der Schwangerschaftsvorsorge wird der Fötus mit Ultraschall dargestellt und untersucht.
Dazu führt der Arzt oder die Ärztin eine etwa handtellergroße Sonde senkrecht über die Haut der entsprechenden Körperregion. Damit die Sonde auch wirklich Kontakt zur Haut hat, kommt zwischen Haut und Sonde ein Gel.
Diese Ultraschallsonde sendet nicht nur Wellen aus, sie empfängt auch das Echo dieser Wellen und leitet es an den Computer weiter. Je nach Zusammensetzung durchqueren die Schallwellen die Organe ungehindert, werden teilweise oder vollständig reflektiert. Aus den Daten produziert der Rechner ein Schwarz-Weiß-Bild aus bis zu 256 verschiedenen Abstufungen. Die Wellen sind weder hör- noch spürbar und völlig ungefährlich.
Wenn es zum Beispiel um die Untersuchung einer Herzklappe geht, können Ärztinnen und Ärzte eine spezielle Ultraschallsonde auch über Mund und Speiseröhre nah an diesen Bereich heranführen.
In der Frauenheilkunde spielt der Ultraschall eine wichtige Rolle, wenn es um die Schwangerenvorsorge sowie das Wachstum und die Entwicklung des Embryos geht. Außerdem können mit einer Sonde durch die Scheide Gebärmutter und Eierstöcke genau untersucht werden.
Röntgen
Beim Röntgen werden elektromagnetische Wellen erzeugt. Diese Wellen fallen auf eine Röntgenplatte, die sich auf der gegenüberliegenden Seite der zu untersuchenden Körperregion befindet. Die Wellen durchqueren also den Körper. Unterschiedliche Gewebe lassen unterschiedlich viel Strahlung durch. Viel Strahlung auf der Röntgenplatte färbt das Bild dunkel, wenig erzeugt helle Stellen. Knochen fangen viel Strahlung ab und sind deshalb hell zu sehen, Muskeln eher dunkel. Das "entwickelte" Röntgenbild wird heutzutage fast immer direkt auf dem Bildschirm eines Computers für den Arzt oder die Ärztin sichtbar gemacht.
Röntgenstrahlen belasten den Körper. Deshalb sollen Röntgenaufnahmen nur dann gemacht werden, wenn es notwendig ist und nicht zu häufig.
Computertomografie (CT)
Im Unterschied zum einfachen Röntgen werden mit dem CT Schicht für Schicht zweidimensionale Aufnahmen erstellt, die der Computer zu einem dreidimensionalen Bild zusammensetzt. Das Ergebnis sind sehr detaillierte Abbildungen, die Aufschluss über krankhafte Veränderungen von Gewebe und Organen ermöglichen.
Bei einer CT-Untersuchung wird der Patient auf einer Liege durch ein ringförmiges, rotierendes Untersuchungsgerät gefahren. Wie beim einfachen Röntgen werden für Strahlen undurchlässige Bereiche wie etwa Knochen hell dargestellt und gut durchlässige Bereich dunkel. Manchmal kann es notwendig sein, ein Kontrastmittel zu geben, um die Organe noch deutlicher unterscheiden zu können.
Auch eine CT-Aufnahme ist eine Belastung durch Röntgenstrahlen und sollte nur dann gemacht werden, wenn sie notwendig ist.
Magnetresonanztomografie (MRT)
Ganz allgemein eignet sich diese Untersuchung, um krankhafte Veränderungen im Körper sichtbar zu machen, also z. B. Entzündungen, Verschleißerscheinungen und Tumore.
Bei der auch Kernspintomografie genannten Methode wird der Patient oder die Patientin auf einer Liege in eine Röhre geschoben und muss dort ruhig liegen. Um die Röhre sind elektrische Spulen verteilt, die ein starkes Magnetfeld erzeugen.
Das MRT ist gleich dem Erdmagnetfeld. Das Erdfeld richtet die Kompassnadel (Metall) aus und das MRT die Wasserstoffatome in unserem Körper. Im MRT wird die Ausrichtung allerdings immer wieder verändert. Die Signale, die dabei im Körper entstehen, lassen sich messen. Je nach Gewebetyp ist die Reaktion anders. Der Computer errechnet aus diesen Signalen ein Schwarz-Weiß-Bild.
Weiche Gewebe lassen sich mit dem MRT besonders gut darstellen. Dazu zählen Gehirn, Herz, Bauchorgane, Bandscheiben, Gelenke, Muskeln, Blutgefäße und die weibliche Brust, weil sie alle viel Wasser enthalten.
Vorbereitung auf ein MRT
Da es sich um ein starkes Magnetfeld handelt, dürfen sich in der Röhre, also auch am oder im Patienten oder der Patientin, keine metallenen Gegenstände befinden. Brillen, Hörgeräte und Zahnspangen müssen also in der Kabine vorher abgelegt werden. Auch Schminke kann eisenhaltige Farbpigmente enthalten.
Problematisch können auch Herzschrittmacher, Defibrillatoren, Insulinpumpen, Innenohrimplantate, Gelenkprothesen oder Zahnimplantate sein. Das muss im Vorfeld mit dem Arzt oder der Ärztin besprochen werden. Und schließlich empfiehlt die Stiftung Gesundheit noch, den Arzt auf etwaige Verhütungsspiralen aus Kupfer, Metallsplitter nach Verletzungen, Schrauben oder Schienen in Knochen sowie Wundklammern oder Gefäßclips und Gefäßprothesen (Stents) hinzuweisen.
Die Untersuchung ist sehr geräuschvoll, meistens bekommt der Patient oder die Patientin deshalb einen Gehörschutz. Menschen mit Platzangst können in der Röhre Probleme bekommen. Dann kann man ein Medikament zur kurzzeitigen Entspannung bekommen.
Haben Sie vielleicht eine Frage, die Ihnen in Ihrem Alltag immer wieder durch den Kopf geht? Stellen Sie sie uns gerne via Sprachnachricht unter +49 151 19589000 und wir suchen die Antwort für Sie.
Wenn Sie unsere Tipps immer direkt auf Ihr Handy bekommen wollen, abonnieren Sie doch ganz einfach unseren Bayern 1 WhatsApp Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029VaHO1q96WaKjXpZjS73K
Der Neurologe und Buchautor Volker Busch, erklärt auf der Blauen Couch, warum wir unser Gehirn vor der ständigen Nachrichten-Berieselung schützen müssen. Hören Sie rein. Und abonnieren Sie gerne den Podcast in der ARD-Mediathek.
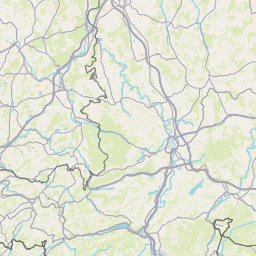
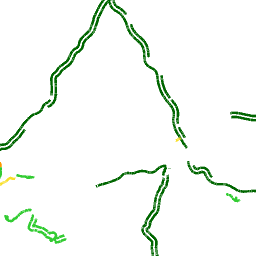
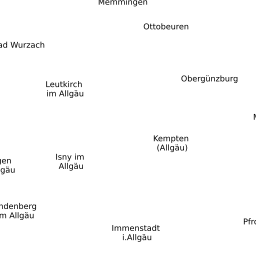
Kommentieren