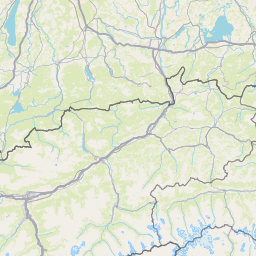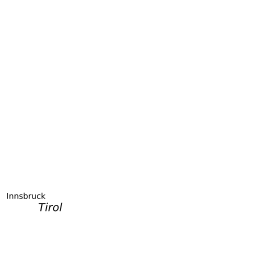Vandalisbin "Ich bin schon als Sechsjährige auf meinen Knien herumgerutscht und habe Luftgitarre gespielt"
Ihr Name klingt nach Vandalismus und Lesbe. Sie spielt Schlagzeug und hat Jazz studiert. Im Interview erzählt die Münchner Musikerin Vandalisbin, wie sie zur Musik kam. Und von einer Begegnung, die ihr Leben veränderte.

In unseren Redaktionscharts „Topp Träxx“ ist sie aktuell auf Platz 12: Die 21-jährige Musikerin Vandalisbin aus München. Eigentlich heißt sie Helena Niederstraßer, hat Jazz studiert und spielt Schlagzeug. Ihre persönlichen Texte schreibt sie auf Deutsch und Englisch. Und sie hat eine unvergleichliche Stimme, die knistert, knackelt – als läge in der Kehle die Seele eines 50-jährigen Türstehers. So hat es ein Pressetext mal treffend beschrieben. Vandalisbin hat als Schlagzeugerin in diversen Bands gleichzeitig gespielt und schon als Teenagerin Straßenmusik gemacht – bevorzugt nachts. So begegnet sie einer Frau, die ihr Leben verändern wird. Im Interview erzählt sie die Geschichte.
Zündfunk: "Vandalisbin" – bei deinem Künstlerinnennamen denkt man direkt an Vandalismus. Was würdest du gerne kaputt machen?
Vandalisbin: Die Idee dahinter ist eine andere. Der Name ist eine Mischung aus „Vandalism“ und „Lesbian“. Der Vandalismus soll mich selbst empowern – sodass mir egal ist, was andere Leute von meiner Musik halten. Ich muss dahinterstehen. Niemand kann mir vorschreiben, einen Sommersong zu machen, weil Sommer ist, oder einen Wintersong, weil Winter ist. Ich bin mein eigener Chef.
Für Neueinsteiger in deine Welt, was willst du den Leuten gern mitteilen?
Ich mache authentische und queere Musik. Aber ich schreibe Musik nicht mit der Frage im Hinterkopf, was ich anderen mitteilen möchte. Sondern als Selbsttherapie. In meinem Song „White Girls“ geht es zum Beispiel um einen inneren Konflikt mit Rassismus, den ich bei anderen bemerke – aber auch in mir selbst. Im Song lasse ich den Ärger darüber raus.
Im Songtext heißt es beispielsweise, „just because you are queer and gay doesn't mean you're always fair.”
Queer zu sein, PoC (Person of Color, Anm. d. Red.) oder Angehöriger einer anderen marginalisierten Gruppe, schützt nicht davor, andere Leute zu diskriminieren. Auch ich selbst habe Rassismus in mir, den ich täglich reflektieren muss.
Du stellst aktuell deine Debüt-EP „Bottle of Wisdom“ vor. Wie bist du zur Musik gekommen?
Laut meiner Mutter bin ich schon als Sechsjährige, als „We Will Rock You“ im Radio kam, auf meinen Knien herumgerutscht und habe Luftgitarre gespielt. Ich habe dann meine Mutter genervt mit: „Mama, Mama, ich will unbedingt Schlagzeug lernen.“ Musikunterricht kostet natürlich, und meine Mutter war alleinerziehend. Es war nicht einfach. Aber irgendwann hat es geklappt. Und ich hatte eine supertolle Musiklehrerin, die mir eine kaputte Gitarre geschenkt hat, die aber noch funktionierte. Darauf habe ich meine ersten Akkorde mit YouTube gelernt. Dann kam die Jazz-Schule und davor – Straßenmusik. Mitten in der Nacht.
Viele Leute meiden die Nacht. Wieso ausgerechnet dann?
Weil ich tagsüber Angst hatte. Von meinem 14. Lebensjahr an habe ich mich immer von Mitternacht bis vier Uhr morgens an den Stachus in der Münchner Innenstadt gesetzt, um Musik zu machen. Tagsüber waren mir zu viele Menschen unterwegs.
Was hast du gesungen?
Eigenkompositionen, Amy Winehouse oder auch AnnenMayKantereit. Alles, was ich als Teenagerin selbst gehört habe. Dann hatte ich super viel Glück, weil eine ultracoole Leiterin einer Stiftung auf mich zugekommen ist. Die hat was in mir gesehen. Zuerst wollte sie mir CDs für die Straßenmusik finanzieren. Wir haben dann über eine Stunde geredet und dann meinte sie zu mir: „Kennst du die Jazz School?“ – „Ja, kostet viel.“ – „Möchtest du dorthin gehen?“ – „Na klar.“ – „Ich bezahle sie dir.“ Und dann, kannst du dir vorstellen, habe ich riesige Augen gemacht, weil ich dachte: „Nee, das gibt's doch nicht.“ Ich wusste nicht mal, was eine Stiftung ist. Ich dachte, die verkaufen Stifte. Sie hat mir tatsächlich die komplette Ausbildung finanziert. Und deswegen sitze ich jetzt vor dir. Das hat mein Leben verändert.
Großartig! Als Straßenmusikerin merkt man sofort, was funktioniert – und was nicht.
Ich würde jedem, der gerne Musik macht oder es wissen will, ans Herz legen, mal Straßenmusik zu machen. Das ist das ehrlichste Publikum. Die Leute bleiben stehen, weil sie wollen, nicht weil sie müssen. Dementsprechend kriegt man sehr gutes Feedback, wie das ankommt, was man macht.
Du hast deine Ausbildung dann mit offiziellem Titel abgeschlossen.
Ja, der klingt total fancy. Ich bin staatlich geprüfte Ensemble-Leiterin.
Du kannst also, mit Stempel, Brief und Siegel bestätigt, einen Chor oder eine Band leiten?
Genau.
Du singst auf Deutsch und Englisch. Erklärung?
"Der Vandalismus soll mich selbst empowern – sodass mir egal ist, was andere Leute von meiner Musik halten."
Ich verbinde mit beiden Sprachen verschiedene Dinge. Deutsch ist meine Muttersprache. Ich bin selbst deutsch. Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Zum Englischen habe ich auch eine eigene Verbindung. Auch wenn ich es spät gelernt habe. Nämlich in Berlin. In der Schule war ich superschlecht in Englisch, hatte immer Fünfer, habe dann aber eine Fernbeziehung gehabt nach Berlin für zweieinhalb Jahre. Und da in der WG meiner Partnerperson die eine aus Brasilien kam, die andere aus Polen, überall her, aber niemand aus Deutschland, haben alle Englisch geredet. Und ich mit meiner Partnerperson auch. Ob ich auf Deutsch oder Englisch singe, kommt auf die Thematik an. Manche Themen, zum Beispiel „White Girls“, würden auf Deutsch komisch klingen. „Ich verliebe mich immer in die weißen Frauen.“ Funktioniert besser auf Englisch. Da kommt auch wieder Vandalisbin ins Spiel. Einfach das machen, worauf ich Lust habe. Und wenn der eine Song englisch und der andere kroatisch wird, dann ist das so.
Von Freiburg bis München – du spielst momentan Konzerte. Wo soll die Reise hingehen?
Ich hoffe, dass ich in zehn Jahren immer noch, wo auch immer, sitze und die Musik mache, die ich machen will. Dass ich akribisch an meinem nächsten Album schreibe über Sachen, die mir dann in zehn Jahren durch den Kopf gehen. Und dass ich entspannt davon leben kann, ohne Paralleljob. Habe ich gerade auch nicht. Ich gehe in die Vollen.