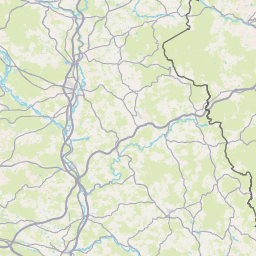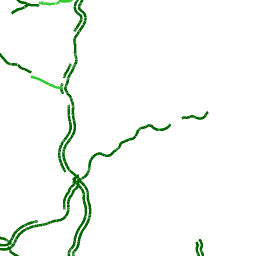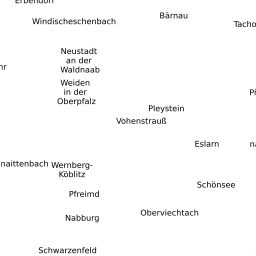Chinesische und abendländische Weltsicht im Vergleich Das Thema

Die antike Zivilisation Chinas beruht auf grundlegend anderen Prämissen und hat sich völlig andersartig entwickelt als die westliche zur Zeit der alten Griechen. So verwundert es nicht, dass sich die klassische chinesische Kultur in elementarer Weise von der abendländischen unterscheidet.
Wesentlich ist, dass die klassische Philosophie Chinas, insbesondere die daoistische, die gesamte Wirklichkeit als einen beständig fließenden Wandel, als ein dynamisches Wechselspiel von Polaritäten auffasst. Zwar spielen Gegensätze seit der Zeit der ionischen Denker auch in der westlichen Philosophie eine Rolle, doch neigen wir stets dazu, diese Gegensätze als Antithesen zu betrachten, die einander nach dem Entweder-oder-Prinzip ausschließen. Dieser Dualismus, auf dem letztlich auch digitale Logik - die operative Basis unserer Computertechnologie - beruht, hat europäische Gelehrte, die sich mit dem geistigen Erbe Chinas vertraut machten, in der Regel zu einer von zwei gegensätzlichen Reaktionen veranlasst: Entweder sie bewunderten die chinesische Denkweise als das Erzeugnis einer nahezu vollkommenen, der unseren weit überlegenen Zivilisation (wie etwa Leibnitz) oder sie werteten sie ab als minderwertigen Ausdruck einer "orientalischen Despotie" (wie etwa Marx). Beide Betrachtungsweisen, die im Westen noch immer vorherrschen, erweisen sich bei näherer Betrachtung als unangemessen.
Um zu verstehen, dass sich die chinesischen und die abendländischen Denkstile nur scheinbar widersprechen, sondern sich vielmehr implementär zueinander verhalten, d.h. gemeinsame Grunderfahrungen der Menschheit auf einander ergänzende Weisen ausdrücken, muss man sich die chinesische Kunst, Komplementaritäten oder Polaritäten überhaupt wahrzunehmen, in ihren Grundzügen angeeignet haben.
Strohpuppen im Kosmos
Inwiefern unterscheidet sich das im Westen dominierende dualistische "Schwarz-weiß-Schema" von dem chinesischen Auffassungsmuster? Schwarz und weiß, "Yin" und "Yang", sind als Polaritäten zu sehen. Schroeder verdeutlicht dies an einigen wesentlichen Grundzügen der klassischen daoistischen Philosophie. Im klassischen Daoismus ist allerdings weniger von "Yin" und "Yang" die Rede - dafür umso mehr vom Dao (oder "Tao"). Der Begriff "Dao" ist zwar ein letztlich unfassbarer Nicht-Begriff, aber dennoch kein dunkles mystisches Rätsel.
Aus dem chinesischen Verständnis des Dao leitet sich auch die für uns ziemlich befremdliche Tatsache ab, dass die Chinesen es sich stets versagt haben, zwischen Naturphilosophie und Sozialphilosophie irgendeinen Unterschied zu machen. Für sie ist alles im Kosmos wie der Kosmos selbst: das Reich als Ganzes ebenso wie der Einzelne, sein Leib und seine Seele. In der Sprache der Fraktalen Geometrie, die bei uns erst vor wenigen Jahren im Zusammenhang mit der so genannten "Chaos-Forschung" entwickelt wurde, würde man von "Selbstähnlichkeit" auf allen Stufen reden. Daher dient das "Naturbild", das die klassischen Schriften des Daoismus entwerfen (und das interessanterweise Ähnlichkeiten mit den modernsten Theorien der westlichen Physik und Kosmologie aufweist), stets zugleich als eine Art Anleitung für den "weisen Herrscher", Staat und Gesellschaft in Harmonie mit jenem Vorbild zu gestalten - oder besser: zu belassen. Denn - so Schroeder - "von Weltenlenkern, Potentaten und tatendurstigen Machern halten die Daoisten rein gar nichts".
Auf die heute so beliebte Frage, was wir, um die drängendsten Weltprobleme in den Griff zu bekommen, nun eigentlich "machen" müssten, haben die Daoisten nur die verblüffende Antwort, dass alle diese Probleme allein durch zuviel "Machen", Beherrschen und gewaltsames Eingreifen in den selbsttätigen Lauf der Welt entstanden seien. "Allerdings teilen die Daoisten auch nicht jene romantische Vorstellung, die einige Advokaten des "New Age" bei uns verbreitet haben, wonach man getrost die Hände in den Schoß legen, sich dem gütigen Walten der Natur vertrauensselig überlasse und verängstigte Klienten allen Ernstes mit der psychotherapeutisch gemeinten Einflüsterung beschwichtigen könne: "Kosmos sorgt schon für dich".
"Solcherlei Naivität würde ja lediglich bedeuten, dass man die Eigenschaften, die sich ein Kind von 'lieben Gott' macht, schlicht auf den Kosmos projiziert - oder auf das, was man dafür hält."
Claus Christian Schroeder
Die alten Chinesen hatten keinen solchen Gott, sie kamen ganz offensichtlich ohne alle Götter, ohne die Vorstellungen eines Schöpfers, ohne Tempel, ohne mächtige Priesterschaften und auch ohne Erlösungsversprechen aus. Kosmos erschien ihnen wohlgeordnet und wunderbar, aber gänzlich unpersönlich und "ungütig". Die Daoisten lehrten, dass sich der Kosmos (oder das Dao) überhaupt nicht um uns kümmert und von unseren individuellen Wünschen oder Befürchtungen keinerlei Notiz nimmt. Dem ständig sich wandelnden Universum - so glaubten sie - gelten die Menschen nicht mehr als jene Strohpuppen, die man im alten China, wenn man sich auf eine Reise begab, überfahren ließ, um üble Weggeister zu beschwichtigen.
"Insofern könnte für unsere moderne säkularisierte Welt, die den verlorenen Glauben auch in mystischen Sektierertum nicht wiederfindet, die kühle, sehr rationale, für spirituelle Höhenflüge wenig geeignete Weisheit der alten Daoisten manche durchaus sinnvolle Orientierung für das verunsicherte Leben des einzelnen bieten."
Claus Christian Schroeder
Die Pflege des Lebens
Im Zentrum diesen Aspekts steht ein chinesischer Philosoph des 4. Jahrhunderts v.Chr. , der im Westen sehr wenig bekannt und in China seit jeher ziemlich verrufen ist: Yang Zhu (auch Yang Chu geschrieben). Seine Lehren, die im weitesten Sinn dem Daoismus nahestehen, uns aber leider nur aus zweiter Hand überliefert sind, wurden vor allem von den Konfuzianern regelrecht verteufelt. Gegen deren staatstragende Doktrin, gegen ihre puritanische Moral, gegen ihren Beamten-Ehrgeiz und ihre Vorliebe für penibel strenge Rituale setzte nämlich Yang Zhu seine auf den ersten Blick ausgesprochen hedonistisch anmutende Philosophie von der "Pflege des Lebens".
Yin-und-Yang-Symbol an der Mauer des Zhong-He-Guan-Tempels im Cangshan-Gebirge westlich von Dali in der Provinz Yunnan, China
Statt nach Ruhm, Ehre, Besitz oder Macht zu streben, sollten die Menschen vielmehr unbekümmert ihren Sinnen und Wünschen folgen und die - ohnehin wenigen - Augenblicke des irdischen Glücks genießen. Wenn man Heraklit zuweilen als den "chinesischsten" unter den antiken Weisen Griechenlands bezeichnet, so könnte man umgekehrt in Yang Zhu einen beinahe "hellenischen" Denker erblicken: Er lehrte einen leidenschaftlichen, für China völlig untypischen, am ehesten aber an Epikur erinnernden Individualismus, den die Nachfolger des Konfuzius als geradezu staatsgefährdenden "Egoismus" verdammten.
Schroeder warnt an diesem Punkt vor voreiligen Schlüssen:
"Man könnte vielleicht glauben, Yang Zhus Philosophie passe ziemlich gut in unsere heutige vergnügungssüchtige 'Ego-Gesellschaft'. Aber das täuscht! Der zeitgenössische Narziss, der nur seinen 'Spaß' will, wird Yang Zhus Philosophie wenig abgewinnen können, denn ihre Grundstimmung ist von tragischer Trauer und von einer Art mutigem Trotz gegen die düstere Gewissheit des Todes getönt - den Yang Zhu als die absolute Grenze des Lebens sieht, also keinesfalls als Übergang in ein besseres jenseitiges Dasein."
Claus Christian Schroeder
Gerade dieses Bewusstsein des "Absurden" jedoch, diese Leidenschaft für ein intensiv sich verströmendes "vivre le plus" und die Entschlossenheit, das Leben gegen die Allgegenwart des Todes (und des Tötens!) zu verteidigen, lassen Yang Zhu als einen verblüffend modernen Geist erscheinen: Seine Gedanken ähneln in vieler Hinsicht denen moderner westlicher Denker, wie etwa Sören Kierkegaard, Albert Camus oder Georges Bataille.