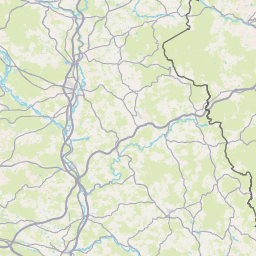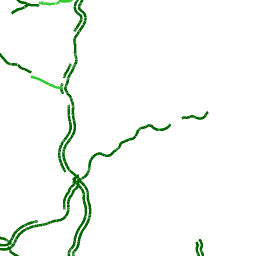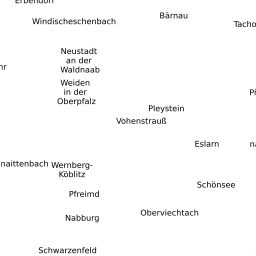Biomüllbeutel Kompostierbare Müllbeutel besser nicht in die Biotonne
Auch wenn Sie in allen Regalen zu finden sind und als "Biomüllbeutel" bezeichnet werden, hält nicht nur die Zeitschrift Öko-Test sie aktuell für ungeeignet.

Die Zeitschrift Öko-Test schreibt in einem aktuellen Bericht vom 27. März 2024, dass Biomüllbeutel zwar immer öfter im Biomüll landen, dafür aber ungeeignet sind.
Kompostierbare Müllbeutel stören beim Kompostieren
Die Anbieter von speziell "kompostierbaren Verpackungen" lassen sich zwar die Abbaufähigkeit meist zertifizieren. Das eingesetzte Bioplastik muss nach drei Monaten zu 90 Prozent verrottet sein. Allerdings unter industriellen Bedingungen.
Öko-Test schreibt dazu: Diese Biomüllbeutel zerfallen zwar innerhalb von drei Monaten zu 90 Prozent in Teile, die kleiner als zwei Millimeter sind, sie bauen sich allerdings erst nach sechs Monaten zu 90 Prozent biologisch ab.
Das ist für die meisten Kompostieranlagen ein Problem. Das dauert zu lange. Die Bioplastikmüllbeutel verunreinigen den Kompost oder verringern seine Qualität.
Betreiber von Kompostanlagen bestätigen das Problem
Die meisten Kompostanlagen in Deutschland können damit nichts anfangen. Deshalb ist die deutsche Entsorgungswirtschaft auch absolut gegen den Einsatz von abbaubaren Kunststoffen in der Biotonne: "Auch die Verordnungen, die es in Deutschland gibt, stehen dem entgegen. Das ist in Deutschland gar nicht erlaubt, dass diese biologisch abbaubaren Kunststoffe in die Biotonne geworfen werden", so Michael Buchheit, Vorsitzender der regionalen Gütegemeinschaft Kompost und Niederlassungsleiter bei Wurzer-Umwelt im Bereich Bioabfall und Grüngut.
Kompostierbare Biomüllbeutel und herkömmlicher Kunststoff
Das Problem ist, dass bei der Sortierung nicht klar unterschieden werden kann, was herkömmliches Plastik ist und was tatsächlich kompostierbar wäre. In der Regel gelangen diese Kunststoffe gar nicht in die Verarbeitung. Selbst wenn die Hersteller versichern, dass schon nach wenigen Wochen sich alles in Wohlgefallen aufgelöst hat: "Labortests oder auch Tests an praktischen Anlagen haben gezeigt, dass auch hochwertige, technisch gut aufgebaute Anlagen es nicht schaffen, innerhalb dieser vorgegebenen Zeiten diese Biokunststoffe abzubauen", sagt Michael Buchheit.
Industrie sieht Biomüllbeutel positiv
Beim weltgrößten Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen, wo auch kompostierbare Verpackungsmaterialien für die internationalen Märkte entwickelt und vertrieben werden, sieht man das natürlich etwas anders. Zu unflexibel und starr seien hier die Strukturen im Entsorgungssektor. "Zum Beispiel in Italien, dort gibt es Zusatzzertifikate, die von den Kompostierern für die verschiedenen Anwendungen herausgegeben werden und die dann sicherstellen, dass es innerhalb des Entsorgungssystems auch Akzeptanz findet", sagt Katharina Schlegel, BASF Global Market Development Biopolymers. Mit den entsprechenden Zertifikaten dürfen dort auch Verpackungen über die Biotonne entsorgt werden.
Kennzeichnung verwirrt Verbraucher
Die Verbraucher sind durch die häufige Kennzeichnung "biologisch abbaubar" verwirrt. Die meisten finden nämlich diese Tüten wesentlich hygienischer als die zugelassenen braunen Papiertüten, die schnell mal durchweichen. Und es gibt einige Kommunen, die diese sogenannten Hemdchentüten in der Biotonne akzeptieren. Das weiß auch Katharina Schlegel von BASF: "Die erlauben diese Beutel und schätzen sie auch sehr wert innerhalb ihres Abfallstroms, weil sie einfach gesehen haben, dass die Leute eine Form von Beutel zum Sammeln von Biomüll wollen und Studien gezeigt haben, dass die Leute mehr sammeln, wenn man ihnen eine Tüte in die Hand gibt." Unterm Strich führe das zu mehr Akzeptanz beim Biomüll und zu einem höheren sowie sortenreineren Aufkommen.
München: Wenn die Abfuhr "Biomülltüten" entdeckt, bleibt die Tonne stehen
Tatsächlich haben viele Kommunen, wie etwa auch München, das Problem, dass sie kompostierbare Müllbeutel im Biomüll zwar verbieten, die Kunden sie aber dennoch reihenweise in die Braune Tonne werfen. Dass unter dem Aufdruck "kompostierbar" noch der Zusatz steht, dass man bei der für Biotonne zuständigen Gemeinde noch mal nachfragen soll, überlesen die meisten. Werden diese Tüten bei Stichproben-Kontrollen entdeckt, ist damit sofort die ganze Tonne für die Kompostierung unverwertbar geworden.
Das Abfallwirtschaftsamt in München empfiehlt: statt einen Biomüllbeutel zu verwenden, ganz einfach ein wenig Zeitungspapier oder unbeschichtete Papierbeutel in einen Behälter legen.
Wie viel Plastik darf im Biomüll sein?
Dass einige Bürger so schlecht oder nicht richtig trennen, wird auch für viele Kommunen und Landkreise zunehmend ein Problem. Es landet einfach zu viel Plastik in der Biotonne. Nach Schätzungen des Bundesverbands Sekundärrohstoffe und Entsorgung (BVSE) sind es bis zu 15 Prozent Fremdstoffe, die eigentlich nicht in die meist Braune Tonne gehören.
Die Kommunen und Landkreise, die für die Müllentsorgung zuständig sind, müssen sich etwas einfallen lassen. Seit der Novellierung der Bioabfallverordnung dürfen Bioabfälle vor der Kompostierung nur noch maximal 0,5 Prozent Kunststoffe enthalten. Kommen die Bioabfälle aus der Biotonne, ist nur noch ein Prozent Plastik erlaubt.
Kompostierbares Plastik: Verpackungen aus Zucker, Milchsäure oder Zellulose
Die Hersteller und Anbieter kompostierbarer Verpackungen sind von ihren Alternativen zum petroleumbasierten Kunststoff natürlich überzeugt. Patrick Gerritsen produziert mit seiner Firma "Bio4Pack" beispielsweise kompostierbare Verpackungen in Nordhorn/Niedersachsen. Die Tüten sehen aus wie herkömmliche, durchsichtige Plastikverpackungen auf Basis von Erdöl. Sind sie aber nicht, sagt Bio4Pack-Geschäftsführer Gerritsen: "Diese Verpackung ist auf Basis von Zellulose und Zucker - zu hundert Prozent kompostierbar. Auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen. Das heißt, ab auf den Komposthaufen und es verschwindet in CO2 und Wasser."
Auch Arnold Schleyer von der Firma "Compostella" im hessischen Laubach verkauft Plastikalternativen: "Wir haben die plastikfreie Verpackung für Wurst und Käse entwickelt. Wir haben ein dichtes Papier genommen. Ein Papier, das aus reiner Cellulose besteht. Und haben es mit einem natürlichen Wachs bestrichen. Und natürliches Wachs heißt in dem Moment: ein Pflanzenwachs." Das Naturwachs stammt von der Carnauba-Palme, einer Wachspalme aus Südamerika.
Beide Produkte könnten Alternativen für Plastikverpackungen im Supermarkt sein. Zumindest in bestimmten Fällen. Die Zuckertüten von "Bio4Pack" sind beispielsweise für Linsen oder Ähnliches gut geeignet, aber Vakuumverpackungen sind ein Problem und besonders hitzebeständig sind die Tüten auch noch nicht: "Es kommt im Laden nicht vor, dass es anfängt zu verrotten", sagt Patrick Gerritsen, "es muss auf den Komposthaufen und dann sind wir innerhalb von zwölf Wochen auch komplett weg."
Bio-Kunststoffe in den Gelben Sack?
Richtig entsorgt sind generell alle Bio-Kunststoffe im Gelben Sack oder der Gelben Tonne. "Alle Verpackungen, die nicht aus Papier oder aus Glas sind, gehören in den Gelben Sack und damit auch die bioabbaubaren oder kompostierbaren Verpackungen", sagt Axel Subklew von der Kampagne "Mülltrennung wirkt!", einer Initiative der dualen Systeme in Deutschland.
Problematisch beim Recycling des Gelben Sacks sind leider insbesondere die Verpackungen, die kompostierbar sind. Beim Reinigungs- und Pflegemittelhersteller Werner & Mertz, die mit ihrer Marke "Frosch" zu den führenden Aufbereitern von Plastik aus dem Gelben Sack gehören, sieht man diese Stoffe kritisch. Sie führen gerade im PET-Strom zu Problemen bei der Verwertung, aber auch bei anderen Kunststoffen: "Das heißt, schon geringe Mengen an kompostierbaren Verpackungen in dem Kunststoffrecycling führen zu massiven Qualitätsverlusten bis hin zu komplett unbrauchbaren Ergebnissen", sagt Timothy Glaze, Leiter Corporate Affairs bei Werner & Mertz.
Noch keine Lösung: Mit Bio-Kunststoff gegen Plastikflut
Gerade im Lebensmittelhandel haben Plastikfolien oder Umverpackungen eine Funktion: Sie sollen vor allem Obst und Gemüse schützen. So fällt auch das Ergebnis eines sechsmonatigen "Unverpackt-Tests" bei Bio-Lebensmitteln in 630 REWE-Märkten im Südwesten Deutschlands eher verhalten positiv aus. Einerseits, berichtet die REWE-Group, könnten (hochgerechnet) bei unverpacktem Bio-Eisbergsalat zwar bundesweit 3.000 Kilogramm Plastik jährlich eingespart werden. Andererseits würden im gleichen Zeitraum voraussichtlich 18,5 Tonnen Bio-Eisbergsalat unverkäuflich, weil die schützende Hülle fehlt. REWE stellte bei seinem Versuch noch etwas Entscheidendes fest: "In der Zeit, wo beispielsweise Bio-Karotten lose angeboten wurden, sank die Nachfrage danach deutlich. Demgegenüber griffen eine zunehmende Zahl an Kunden nach den verpackten, konventionellen Möhren."
Erforschung von alternativen Bio-Kunststoffen in Bayern
Das Problem vieler Verpackungen aus biologisch abbaubaren Kunststoffen ist ihre Konkurrenzsituation zum Futter- bzw. Lebensmittel-Einsatz. So bei Zuckerrohr, aber auch Mais oder anderen Kulturpflanzen.
In Bayern sucht die Forschung alternative Verpackungsmaterialien. An der Technischen Hochschule Nürnberg arbeitet Prof. Dr. Stephanie Stute zum Beispiel mit Bakterien. Unter bestimmten Bedingungen stellen die Poly-Buttersäure (PHB) her. Wird der das Wasser entzogen, bleibt ein Granulat. Das eignet sich zur Herstellung von Verpackungsmaterial wie Tüten oder Folien oder Einweggeschirr. Der Prozess ist bisher teuer und die Marktreife dürfte noch Jahre dauern.
Die Chemikerin Dr. Sabine Amberg-Schwab entwickelt mit ihrem Team am Fraunhofer-Institut in Würzburg kompostierbare Barriere-Schichten für Verpackungen. Fühlt sich an wie Plastik, hat dieselben Eigenschaften wie Plastik, ist aber komplett kompostierbar und zerfällt in Wasser, CO2 und ein wenig Sand.
Für den Alltag ist aber wichtig, dass die Produkte die Vorgaben der EU erfüllen und in modernen Kompostieranlagen beim Zersetzungsprozess mithalten können.
Ganz entscheidend ist, dass die Verbraucher die Alternativen akzeptieren.
Hier lesen Sie "Was darf in die Biotonne"
Quellen:
Podcast "Besser leben. Der BAYERN 1 Nachhaltigkeitspodcast"
Auch kompostierbare Plastiktüten führen immer noch zu Probleme. Hören Sie Lösungsansätze in dieser Folge unseres Nachhaltigkeitspodcasts "Besser leben".
Alle Episoden zum Nachhören und die neue Staffel gibt's jederzeit und kostenlos in der ARD Audiothek. Einfach abonnieren.
https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/wie-gut-sind-kompostierbare-verpackungen-wirklich/bayern-1/85076920/
Ist das Eco-Programm der Spülmaschine wirklich umweltfreundlich, auch wenn es stundenlang braucht? Gibt es wirklich nachhaltige Kaffeekapseln? Wenn Sie auch so eine Frage aus Ihrem Alltag haben, schreiben Sie uns.