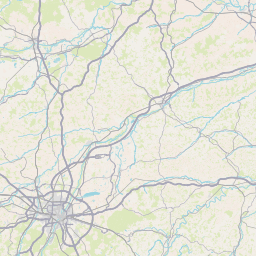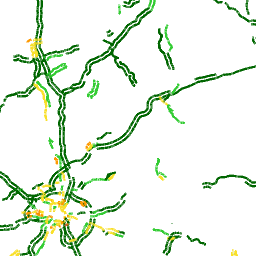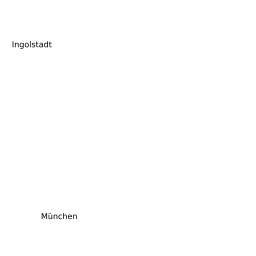Einsam oder geme einsam Das Thema

Ich oder wir? Eine Alternative, die sich in Reinform nicht stellt. Denn Ich ist auch Wir. Das Individuum ist ein soziales Phänomen. Es findet seine Identität in Gruppen, zuallererst in der Herkunftsfamilie. In Gruppen übt der Mensch soziale Verhaltensweisen ein, positive und negative. Gruppen prägen seine Art zu denken und zu fühlen.
Obwohl jeder Mensch andere Menschen dringend braucht, wollen die meisten hin und wieder auch mal für sich sein. Wer einsam ist, kann ungestört entspannen, schöpferischen Impulsen nachgehen, sich frei fühlen von Reglementierungen und Anpassungszwängen. Gemeinschaft schränkt ein, setzt Grenzen. Dichter und Denker, wie zum Beispiel der Philosoph Arthur Schopenhauer, stehen ihr oft skeptisch gegenüber: „Zwang ist der unzertrennliche Gefährte jeder Gesellschaft, und jede fordert Opfer, die um so schwerer fallen, je bedeutender die eigene Individualität ist.“ Für die Mystiker ist Einsamkeit sogar ein Gnadenstand, Voraussetzung für das Einfließen Gottes in die Seele.
Trotzdem: Ist die Einsamkeit nicht frei gewählt, nimmt sie überhand, erkrankt der Mensch. Er hat ein angeborenes Bedürfnis nach Bindung, nach Zugehörigkeit. Er braucht die anderen als Spiegel, als Vorbild, als Gefährte, als Gegner. Gruppen weisen eine gewisse Homogenität auf, sie haben soziale Normen, und der Einzelne tut viel, um ihnen zu entsprechen. Er leistet sich teure Statussymbole, die er eigentlich nicht braucht. Er passt seine Sprache, sein äußeres Erscheinungsbild den Menschen an, von denen er akzeptiert werden möchte. Er nimmt in Kauf, dass er sich verändern muss, wenn er einer Gemeinschaft angehören will; er akzeptiert, dass ihre Rituale, ihre Ansprüche ein Teil seines Selbst werden.
Gruppen erfordern Anpassung. Schon in der Familie stoßen die Affekte und Triebansprüche des Kindes auf Schranken. Der Mensch wird Mensch durch die Sublimierungsleistungen, die seine Sozialisation ihm abverlangt. Das Individuum, so Alexander Mitscherlich in „Massenpsychologie ohne Ressentiment“, „ist von Anfang an ein sozial vergewaltigtes Wesen“.
Soziale Rollen
Diese Anpassungsleistung wird dem Individuum dadurch erleichtert, dass es Rollenzuweisungen vorfindet und verinnerlicht. Rollen stellen einen Komplex von Verhaltensvorschriften und Erwartungen dar, die sich an alle Individuen in einer bestimmten sozialen Position gleichermaßen richten. Sie sind mehr oder weniger verbindlich, schränken den individuellen Entfaltungsspielraum einerseits ein, vermitteln aber andererseits auch soziale Geborgenheit. Keine Gesellschaft kommt ohne Rollenzuweisungen aus, doch keine Gesellschaft kann verhindern, dass der Einzelne einen Spielraum hat, in dem er seine Freiheit behauptet. Geschlechterrollen ändern sich, die Rolle der Kinder in der Gesellschaft ebenfalls, selbst die Rolle des Chefs oder der Sekretärin in einer Firma. Rollenüberschreitungen bringen Neues in eine Gemeinschaft, sie ermöglichen die Entstehung neuer Formen des Zusammenlebens.
Der Rausch des Kollektiven
Selbstbehauptung ist anstrengend, denn die Position eines Individuums in seinen konkreten Lebensverhältnissen – Familie, Firma, Freundeskreis – ist nicht statisch, sie will erkämpft und verteidigt werden, man muss sich abgrenzen. Das gehört zum Alltag. Sportereignisse wie die Fußballweltmeisterschaft oder Großveranstaltungen wie das Oktoberfest sind nicht zuletzt deshalb so beliebt, weil sie die Banalität des Alltäglichen transzendieren. Sie schaffen neue, übergreifende Gemeinschaftserlebnisse, vermitteln dem Einzelnen neue Formen der Selbsterfahrung. Soziale Unterschiede werden nivelliert, soziale Konflikte treten in den Hintergrund. Auch der Nationalrausch ermöglicht den seelischen Ausbruch aus den Beschränkungen konkreter Lebensverhältnisse. Das Hochgefühl, ein „Deutscher“ zu sein, kompensiert den Mangel an Selbstwertgefühl.
Theorie der Masse
Massenerfahrungen ermöglichen die Erfahrung von Gleichheit und großer Nähe und sind daher allgemein beliebt. Sie beseitigen die Abstände und die Berührungsfurcht zwischen Menschen, schreibt der Schriftsteller Elias Canetti in „Masse und Macht“. „Es ist die dichte Masse, die man braucht, in der Körper an Körper drängt, dicht auch in ihrer seelischen Verfassung … Sobald man sich der Masse einmal überlassen hat, fürchtet man ihre Berührung nicht. In ihrem idealen Fall sind alle gleich. Keine Verschiedenheit zählt, nicht einmal die der Geschlechter. Wer immer einen bedrängt, ist das gleiche wie man selbst. Man spürt ihn, wie man sich selber spürt.“ Elias Canettis Theorie der Masse kommt ohne moralische Prämissen aus, sie ist beschreibender Natur. Bei Gustave Le Bon, dem Gründervater der Massentheorie, sind – wie bei vielen seiner Nachfolger - deutliche Ressentiments zu spüren. Für ihn sind die Eigenschaften der Massenseele denen der Kinder, der Frauen, der Wilden ähnlich: „Die Einseitigkeit und Überschwenglichkeit der Gefühle der Massen bewahren sie vor Unsicherheit und Zweifel. Den Frauen gleich gehen sie sofort bis zum Äußersten“ („Psychologie der Massen“). Die Herrschaft der Massen ist bei Le Bon ein Verfallssymptom, es bedroht die menschliche Kultur. Dieser kulturpessimistische Ansatz ist bei den frühen Massentheoretikern weit verbreitet, hat aber bei modernen Theoretikern wie Mitscherlich und Canetti eine Relativierung erfahren.
Individualismus und Werteverfall
Und dennoch ist das Verhältnis zwischen dem Einzelnen und der Gemeinschaft immer noch Dauerthema der Kulturkritik. Oft wird dem Individualismus moderner westlicher Gesellschaften die Schuld am Verfall alter traditioneller Werte und Bindungen gegeben. Dem widerspricht Richard Herzinger in der ZEIT (15/1997): „Verantwortungsbewusstsein und zivile Formen im Umgang mit anderen können nur aus der selbstverantwortlichen Ausübung individueller Freiheit entstehen. Erst das Bewusstsein, ein vereinzeltes Individuum mit allen positiven und negativen Anlagen zu sein, macht es überhaupt erst möglich, den anderen in seiner Individualität anzuerkennen und ihn nicht bloß als Repräsentanten eines Kollektivs zu betrachten.“
Ich und wir - ein Wechselspiel
Weder die Flucht in den Rausch des Kollektiven noch die Glorifizierung der Einsamkeit vermag tragfähige Selbst- und Welterfahrung zu vermitteln: Wer bei der Suche nach sozialer Geborgenheit das Ich geringschätzt und missachtet, wird keine konstruktiven Gemeinschaftserfahrungen machen. Eine lebendige Gruppe ist auf das Eigene, das Unverwechselbare ihrer Mitglieder angewiesen, das immer wieder zur Überschreitung drängt, immer Reibung erzeugt im Gefüge sozialer Normen. Doch wer sein Eigenes zur Geltung bringen will, braucht die Kommunikation mit dem Du, den Austausch mit der Gemeinschaft, die Auseinandersetzung mit Rollenerwartungen. Dieses Wechselspiel kommt nie zur Ruhe und kennt keine endgültige Lösung; es ist ein Grundmerkmal des Lebendigen und des Sozialen.