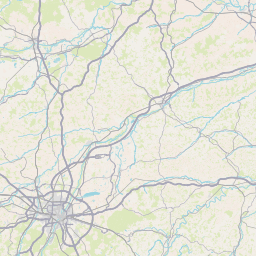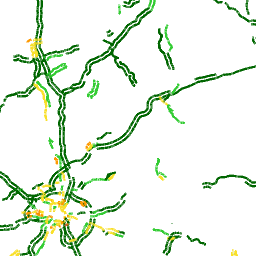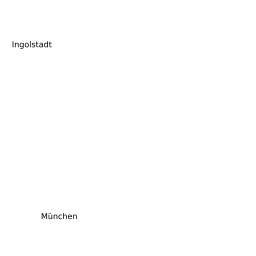Phobien und Paniken Leben mit Angststörungen
Angst kennen alle. Sie gehört zur emotionalen Grundausstattung des Menschen. Manchmal aber verselbständigt sich die Angst. Dann wird das Gefühl selbst zum Problem.

Das Zittern vor einer Prüfung. Die Furcht auf einem einsamen Weg. Angst kennen alle. Sie gehört zur emotionalen Grundausstattung des Menschen. Denn sie warnt uns vor Gefahren, vermeintlichen wie echten.
Ein Sinneseindruck oder ein Gedanke kann der Auslöser sein. Der Pulsschlag erhöht sich, kalter Schweiß bricht aus, im Bewusstsein macht sich Panik breit. Angst mobilisiert im Extremfall den ganzen Organismus. So wird eine Fluchtreaktion möglich. Dieser physiologische Mechanismus sichert das Überleben. Er ist tief im neurobiologischen System verankert. Manchmal aber verselbständigt sich die Angst. Dann wird das Gefühl selbst zum Problem.
Dem Text liegt ein Interview mit Prof. Reinhart Schüppel, Chefarzt der Johannesbad Fachklinik Furth im Wald, zugrunde.
Das Gefühl der Angst zu kennen, ist lebenswichtig. Wer sich nie fürchtet, überschätzt seine Kräfte schnell. Wer allerdings vor jeder Herausforderung kneift, blockiert sich selbst. Aber das richtige Maß lässt sich nicht so leicht definieren. Denn jeder Mensch ist anders. Was manche lockt, schreckt andere ab. Und wegen "Feigheit" wird niemand zum Arzt gehen. Da muss schon mehr zusammenkommen.
Angststörungen gehören noch vor Depressionen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. 15 bis 20 Prozent der Deutschen leiden im Laufe ihres Lebens an eigentlich behandlungsbedürftigen Panikattacken oder Phobien. Aber nicht jeder macht gleich eine Therapie. Viele versuchen erst einmal, die angstauslösenden Situationen zu vermeiden.
Angst oder Befürchtungen zu haben, ist etwas durch und durch Normales. Deshalb gilt ein "mulmiges Gefühl", das sich aushalten lässt, noch nicht als Anzeichen einer krankhaften Angststörung. Erst wenn die Angst der Situation nicht mehr angemessen ist oder sie länger anhält, als es "üblich" wäre und wenn sie die Betroffenen im Leben einschränkt, beginnt in der Regel eine Leidensgeschichte.
Oft entstehen die Probleme erst durch eine Angst vor der Angst. Viele Menschen mit unbehandelten Angststörungen entwickeln ein Vermeidungsverhalten. Sie gehen den Auslösern ihrer Ängste und unangenehmen Situationen aus dem Weg. Das ist im Prinzip eine natürliche Reaktion. Aber so reduzieren sich meist Kontakte und Aktivitäten. Der individuelle Bewegungsradius schränkt sich ein. Hinzu kommt: die Angst vor der nächsten Angstattacke belastet.
Das Vermeidungsverhalten befördert den Rückzug aus dem "normalen" Alltagsleben. Mit der sozialen Isolation jedoch wächst das Risiko einer Depression. Umgekehrt haben depressive Menschen oft Ängste, vor allem Zukunftsängste. Bei der Diagnostik muss also unterschieden werden, ob zuerst die Angst oder die Depression da war. Bei der Therapie kann man aber beide gleichzeitig angehen.
"Wenn die Angst ausgeprägt ist, bedrückt das die Betroffenen natürlich. Die Kollegen gehen zum Bergsteigen. Und ich habe eine Angststörung und sage: 'Geht mal lieber ohne mich.' Deswegen gibt es eine Diagnose, die heißt: Angst und Depression gemischt, also halb / halb. Aber in der Regel entscheiden wir Fachleute uns für die Störung, deren Symptome weit im Vordergrund stehen."
Prof. Dr. Reinhart Schüppel, Chefarzt der Johannesbadklinik Furth im Wald
Generell gilt: Menschen mit Angststörungen haben
- keine depressive Grundstimmung, zumindest am Anfang
- keine Antriebsstörung, also keine Probleme, sich zu motivieren
- keine "fremd" wirkenden, zwanghaften Rituale oder Tics
Nicht wenige Menschen mit Angststörungen greifen in ihrer Not zu Alkohol oder Beruhigungsmitteln, weil sie die kurzfristig angstlösende Wirkung der Substanzen schätzen. Allerdings bewirken diese Selbsthilfeversuche - langfristig betrachtet – zwar durchaus Lernerfolge, aber leider keine positiven:
"Viele Menschen stellen fest, dass z. B. ihre Schüchternheit verschwindet, wenn sie Alkohol trinken oder Cannabis rauchen. Und wenn sie das oft tun, dann macht ihr Hirn einen Lernprozess durch. Es gewöhnt sich an die Substanz. Und irgendwann braucht man dann gar keine Angst mehr, um den Alkohol zu trinken oder den Cannabis zu konsumieren. Und dann steht man mit zwei Beinen in der Sucht."
Prof. Dr. Reinhart Schüppel, Chefarzt der Johannesbadklinik Furth im Wald
Angst ist eine ziemlich anstrengende Emotion. Sie raubt dem Körper Energie. Und sie kann tatsächlich "die Seele auffressen" - wenn man sich keine Hilfe holt.
Die entscheidende Frage lautet: Wer kontrolliert wen? Die Person ihre Gefühle oder die Gefühle die Person? Im Extremfall ist die Angst bzw. die Angst vor der Angst so groß, dass sich die Betroffenen dem Gefühl ausgeliefert fühlen. Die Angst hält das Leben umklammert und beeinflusst viele Entscheidungen, oft zum Negativen.
Zur Definition einer Angststörung braucht es immer zwei Leute: den Betroffenen selbst und einen Menschen vom Fach. Nur wenn ein Psychologe oder eine Psychiaterin die Angst ebenfalls als unangemessen einschätzt, kann von einer behandlungsbedürftigen Störung gesprochen werden. Denn Angst ist ja eigentlich ein natürliches Gefühl, das sich bei jedem eben anders zeigt.
"Zum Beispiel überfallen jemanden immer leichte Beklemmungen, wenn er ein Kaufhaus betritt. Länger als eine Viertelstunde hält er es dort nicht aus. Die Frage stellt sich: Ist das schon eine Klaustrophobie, also eine Angst vor engen Räumen oder nicht? Man wäre mit einer Therapie vielleicht zurückhaltend, wenn der Patient sonst keine weiteren Einschränkungen erlebt. Wenn er allerdings auch nicht U-Bahn fahren kann und deshalb weite Umwege in Kauf nimmt, dann würde seine Problematik durchaus die Kriterien einer Krankheit erfüllen."
Prof. Dr. Reinhart Schüppel, Chefarzt der Johannesbadklinik Furth im Wald
Die Diagnostik basiert auch im Zeitalter moderner Methoden überwiegend auf dem Gespräch mit den Patienten. Psychologische Tests ergänzen es. Die Psychiaterin oder der Psychologe müssen die Symptome gemeinsam mit dem Betroffenen "entdecken" - auch um andere psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Zwangsstörungen auszuschließen. Deshalb stellen sie viele Fragen:
- Ist die Person ständig von Angst erfüllt? Oder tritt die Angst nur in bestimmten Situationen auf? Gibt es Auslöser? Oder überfällt den Menschen unvorbereitet große Furcht?
- Wie häufig tritt die Angst auf? Wieviel Prozent des Alltags werden angstfrei erlebt?
- Was passiert während der Angstzustände körperlich und seelisch? Reagiert die Person mit Schwindel oder Herzrasen? Hat sie das Gefühl, "verrückt" zu werden? Kommt es zu Todesangst?
- Welche Verhaltensweisen verändert die Angst im Alltag?
Das Ergebnis lässt eine Einordnung zu, ob der Betroffene eine Angststörung hat. Und wenn ja, welche Form.
Ängstlich-vermeidende Persönlichkeiten haben von Haus aus einen sehr vorsichtigen und zurückhaltenden Charakter. Oft bekommen sie wegen ihres eher konfliktscheuen Verhaltens Probleme, die aber wiederum ihre Befürchtungen und Sorgen verstärken.
Menschen, die an einer generalisierten Angststörung leiden, sind "dauerangespannt". Ihnen erscheint das gesamte Leben als gefährlich oder schwierig. Ihre Angst ist nicht konkret, sondern diffus.
Rätselhaft wirken oft die Phobien. Bestimmte Gegenstände wie Scheren oder Lebewesen wie Spinnen lösen, ohne dass es vorher zu unangenehmen Erfahrungen gekommen wäre, heftige Symptome aus. Bei einer Klaustrophobie ist es z. B. die Enge eines Fahrstuhls, die die Angst hervorruft. Als soziale Phobie gilt die Angst sich vor anderen zu blamieren, sich in einer Gesellschaft daneben zu benehmen oder z. B. vor einer Gruppe sprechen zu müssen.
Dramatisch wirken Panikattacken, die Menschen aus heiterem Himmel überfallen. Die Betroffenen erleben urplötzlich ein elementares Gefühl von Bedrohung und Todesangst. Das Hauptproblem dabei ist: Weil die Panikattacken so unvermittelt und unvorhersehbar auftreten, entwickeln die Betroffenen große Angst vor den Anfällen und stellen ihr gesamtes Verhalten dementsprechend um.
"Das heißt, um keine Panikattacke zu bekommen bzw. um sich dabei nicht zu schaden, hört die betroffene Person z. B. mit dem Autofahren auf. Denn wenn sie auf der Autobahn bei 140 Stundenkilometer eine Panikattacke erlebt, macht sie vielleicht einen gefährlichen Fehler. Und deshalb fährt sie lieber nie wieder Auto oder nur kurze Strecken." Prof. Dr. Reinhart Schüppel, Chefarzt der Johannesbadklinik Furth im Wald
Massive Angst spielt auch eine Rolle bei Menschen, die unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden. Erinnerungen oder irgendwie ähnliche Situationen "triggern" die Angstzustände. Der Zusammenhang mit dem traumatischen Ereignis ist deutlich erkennbar.
Angst warnt vor Gefahren. Ohne Angst hätten wir keine Überlebenschance. Angst gehört zur neurobiologischen "Grundausstattung" des Menschen.
Kollektive Angstreaktionen, wie z. B. die vor Schlangen, sind tief ins Unterbewusste eingebrannt. Jedes Individuum erlebt allerdings auch seine eigenen Schrecken. Und manche suchen geradezu den Adrenalinflash, Extremsportler etwa. Andere mögen die Mischung aus Faszination und Angst wie sie Horrorfilme auslösen. Angst macht im besten Fall angenehm lebendig – vor allem, wenn man sie wohldosiert auf dem Sofa erlebt.
Angst oder eben nicht in Pandemiezeiten
In der aktuellen Corona-Pandemie können noch weitere Faktoren hinzukommen. Da das Virus unsichtbar bleibt und nur die vielfältigen Folgen zu spüren sind, können viele ganz harmlose Situationen plötzlich gefährlich erscheinen. Manche ziehen sich deshalb lieber ganz vom sozialen Leben zurück, andere reagieren kontraphobisch: Warnungen nehmen sie kaum noch ernst, sie fühlen sich unverletzlich und gehen hohe Risiken ein. Deshalb sind sicher nicht ganz zufällig Angsterkrankungen in den vergangenen zwei Jahren um ein Viertel angestiegen. Die Auswirkungen der weiteren Herausforderungen wie die großen wirtschaftlichen und politischen Sorgen sind dabei noch gar nicht eingerechnet.
Das menschliche Gehirn ist ein großes Netz- und Schaltwerk. Im Laufe des Lebens macht der Mensch unentwegt neue Erfahrungen. Er lernt ständig. Aber seine Nervenzellen verknüpfen sich nicht zwangsläufig nur "richtig", also zum biologischen und psychischen Vorteil. Zu viele Einflüsse sind wirksam. Auch das Angstgedächtnis formt sich höchst komplex aus.
Wie ein Mensch Angst erlebt, hängt von drei Faktoren ab:
Die angeborene Veranlagung
Genetische Eigenschaften liefern die Grundlage dafür, ob jemand eine eher ängstliche oder mutige Persönlichkeit entwickelt. Hier können auch transgenerationale Übertragungsprozesse eine Rolle spielen: tief traumatisierende Erlebnisse der Eltern oder Großeltern hinterlassen sogenannte "epigenetische" Spuren im Erbmaterial. Sie könnten eine der Ursachen sein, wenn in der Generation der Kinder oder Enkel unerklärliche Ängste auftreten. Hier steht die Aufklärung von "An- und Abschaltvorgängen" von Genen noch am Anfang der Forschung.
Erworbene Verhaltensmuster, vor allem durch Erziehung
Eltern vermitteln ihren Umgang mit dem Gefühl der Angst. Kinder lernen von ihnen, ob Angst etwas selbstverständlich Zum-Leben-Gehörendes ist oder ob es ein katastrophales Gefühl ist, das es zu meiden gilt. Sie lernen, ob Angst auch wieder weggeht oder unterschwellig immer da ist. Und ob es sich lohnt, als Gegenmittel Mut und Selbstbewusstsein einzusetzen oder nicht.
"Es ist ein Unterschied, ob mir meine Eltern etwas zutrauen, ob ich also als Kind auf den Baum raufklettern darf oder ob meine Mutter drunter steht und ruft: Komm runter, das ist gefährlich, du kannst dir was brechen! Es ist ein Unterschied, ob ich das Gefühl insgesamt bekomme, na ja, mir wird schon nix Schlimmes passieren oder ob ich auf den Weg mitbekomme: lieber nichts riskieren!"
Prof. Dr. Reinhart Schüppel, Chefarzt der Johannesbadklinik Furth im Wald
Eltern oder andere Bezugspersonen prägen Kinder in ihrem Verhältnis zum Leben. Wenn alles gut geht, vermitteln sie ihnen Urvertrauen, also das Gefühl, grundsätzlich in der Welt geborgen zu sein - was den Umgang mit Ängsten enorm erleichtert. Die moderne Bindungsforschung spricht von sicher gebundenen Kindern, wenn der Nachwuchs eine vorübergehende Trennung von Mutter oder Vater aushalten kann, ohne in Panik auszubrechen. Das Vertrauen, dass die Eltern ganz bestimmt wiederkommen werden, stärkt sie. Sicher gebundene Kinder entwickeln weitaus weniger Ängste als unsicher gebundene.
Soziale und gesellschaftliche Umstände
Wer in prekären Verhältnissen aufwächst, bekommt schon von klein auf Sorgen mit: Geld, Wohnen, Essen, Arbeiten – alles ist ein Problem. Ähnlich kann ein von Krisen gebeuteltes gesellschaftliches System zur psychischen Destabilisierung einzelner Menschen beitragen. Dies muss uns aktuell gerade in den Therapieberufen zu großer Sensibilität veranlassen.
"In einem achtsamen Umfeld fällt es leichter, Probleme als Herausforderungen zu betrachten. Aber wenn die Luft verschmutzt ist oder abgebrannte Brennstäbe kein Endlager finden, ist es auch nachvollziehbar, dass Menschen Ängste entwickeln."
Prof. Dr. Reinhart Schüppel, Chefarzt der Johannesbadklinik Furth im Wald
Wer medizinische oder psychologische Hilfe sucht, interessiert sich vielleicht nicht vorrangig für die Ursachen seiner Panikzustände. Ein Kranführer, der eine Höhenangst entwickelt hat, will möglicherweise schnell wieder arbeiten können und nicht zuerst seine Kindheit erforschen. Trotzdem suchen Therapeuten nach den Auslösern. Denn die Hintergründe sind für die Behandlung wichtig. Manchmal hängt die Ursache der Ängste nicht mit dem Symptom zusammen. So plagen den Kranführer vielleicht Eheprobleme und seine seelische Überforderung sucht sich nur "irgendein" Ventil. Höhenangst ist nämlich ziemlich verbreitet. Obwohl die wenigsten Menschen ständig auf Kirchtürmen oder Bergspitzen zu Gange sind:
"Mit schlimmen Erfahrungen hat Höhenphobie nur äußerst selten zu tun. Es handelt sich schlicht und einfach um eine Fehlschaltung des Gehirns."
Prof. Dr. Reinhart Schüppel, Chefarzt der Johannesbadklinik Furth im Wald
Überstandene Operationen oder körperliche Leiden befördern die Ängstlichkeit. Vor allem Krankheiten, die lebenswichtige Organe wie Herz oder Lunge betroffen haben, erschüttern die Betroffenen im Nachhinein oft seelisch mehr als sie zunächst annahmen. Keine Luft bekommen zu können, die Todesangst und die Schmerzen vor einem Herzinfarkt: Die Begleiterscheinungen des schlimmen Ereignisses haben sich als lebensbedrohliche Erfahrungen ins Gedächtnis eingeprägt. Nun kann alles, was daran erinnert, Panik auslösen – sei es ein hoher Blutdruckwert, ein schneller Puls oder beginnende Atemnot.
Angst zu vermeiden ist letztlich unmöglich. Umso mehr gilt es, sie als Teil der menschlichen Existenz zu akzeptieren.
Man entkommt ihr nicht. Vermeidungsstrategien ändern nichts an den Ursachen einer Angststörung. Oft verfestigen sie sogar das Gefühl der Ohnmacht. Manchmal aber wächst sich ein Angst-Problem auch aus. Vor allem dann, wenn das befürchtete Fiasko über Jahre hinweg nicht eintritt. Das Leben belehrt dann den Menschen eines Besseren.
Eine gute Nachricht lautet: Der Mensch bleibt bis ins hohe Alter lernfähig. Er kann neue, andere Erfahrungen machen, auch mit sich selbst. Die psychotherapeutische Behandlung von Angststörungen setzt hier an. Selbstverständlich gibt es für akute oder besonders schwere Fälle auch wirksame Medikamente.
- Medikamente, die "nur" die Symptome lindern, wie Benzodiazepine. Diese Arzneimittelgruppe ist dem Notfall vorbehalten, denn sie kann zur Sucht führen und löst keinen positiven Lerneffekt aus.
- Medikamente, die langfristig in den Stoffwechsel des Gehirns eingreifen und dort die ängstliche Grundstimmung lindern, etwa Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer
- sowie Medikamente, die eher indirekt, z. B. durch Reduktion von Stresssymptomen wirken, wie bestimmte Betablocker
"Eine klassische Behandlung besteht darin, Menschen mit Panikattacken mit einem Notfallmedikament zu versorgen, das ist ein Benzodiazepin, das besonders gut gegen Angst wirkt. Das tragen viele Patienten im Geldbeutel bei sich. Aber sie nehmen es praktisch nie. Die Sicherheit, dass sie es schlucken könnten, aber nicht müssen, weil sie gelernt haben, mit der Angst umzugehen, trägt zum Erfolg der Therapie bei."
Prof. Dr. Reinhart Schüppel, Chefarzt der Johannesbadklinik Furth im Wald
Bei Angststörungen gelten verhaltenstherapeutische Verfahren als besonders wirksam. Das Mittel der Wahl ist die "Exposition". Das heißt: Patienten üben sich in genau dem, wovor sie Angst haben. Man führt sie in mehreren Stufen an ihr "Angst-Thema" heran. Zuerst gehen sie unter therapeutischer Anleitung die Situation gedanklich durch. Dann üben sie mit therapeutischer Unterstützung, z. B. in der U-Bahn oder im Lift. Oder man nutzt virtuelle Simulatoren. In der dritten Phase setzen sich die Patienten dann alleine der angstauslösenden Situation aus. Und zwar solange, bis die Symptome nicht nur auftauchen, sondern auch wieder deutlich abflauen. Das Motto heißt: Nicht weglaufen, sondern durchhalten, bis die Angst geht!
"Eine Patientin hat z. B. die Angst, dass sie im Supermarkt ohnmächtig umfällt. Nach heftigen Angstsymptomen zu Beginn merkt sie, dass der Schwindel und Schweißausbrüche besser werden und das Befürchtete einfach nicht eintritt. So kann das Gehirn eine neue Erfahrung machen: Ich bekomme im Supermarkt keine Ohnmacht. Jetzt muss man das wiederholen, wiederholen und wiederholen. Und, das ist vielfach belegt: Irgendwann können diese Menschen wieder ganz normal ins Kaufhaus gehen."
Prof. Dr. Reinhart Schüppel, Chefarzt der Johannesbadklinik Furth im Wald
In manchen Fällen lohnt es sich, nach tieferen Ursachen einer Angststörung zu forschen; und zwar immer dann, wenn die Angst als Symbol eines anderen Problems erscheint. Junge Leute z. B., die Panikattacken erleiden, sobald sie von zu Hause wegfahren, haben vielleicht Schwierigkeiten, sich von ihren Eltern abzulösen. In tiefenpsychologischen Verfahren bekommen die Patienten die Zeit und den Raum, um etwaigen Trennungsängsten nachzuspüren. Meist verschwinden die Symptome, sobald die Betroffenen die seelischen Zusammenhänge erkennen und neue "korrigierende Erfahrungen" in der therapeutischen Beziehung machen können.
Wenn hinter der Angst ein Trauma steht, kommen spezielle Therapien zur Anwendung. Hierzu gehört das Erlernen besonderer Techniken, um die Erinnerung an das schreckliche Erlebnis zunächst besser in den Griff zu bekommen (wie z. B. durch eine Übung zum sicheren Ort der gedanklich Schutz gibt. Durch spezielle Therapieverfahren kann es dann auch gelingen, das Trauma psychisch in das aktuelle Leben integrieren zu können. Hier helfen speziell ausgebildete Traumafachleute weiter.