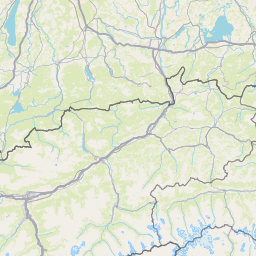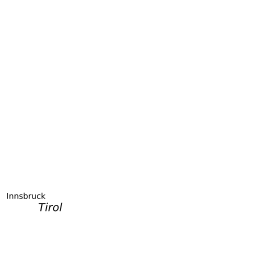Ehemalige Korrespondentin Susanne Glass Wien, Tel Aviv und eine Schatztruhe voller Erinnerungen
Nach 16 Jahren im Studio Wien wechselte Korrespondentin Susanne Glass 2016 nach Tel Aviv und berichtete für die ARD aus Israel. Nun kehrte sie zurück nach München. Mit im Gepäck: unzählige Erinnerungen an eine Region voller Widersprüche.

BR.de: Nach 16 Jahren im Studio Wien mit einem Berichtsgebiet von zwölf Ländern in Südosteuropa sind Sie 2016 nach Tel Aviv in Israel gewechselt. Was hat sich dabei für Sie geändert?
Susanne Glass: Ein Kollege hat mir zum Abschied die Weltkarte unter die Nase gehalten und augenzwinkernd gesagt: "Schau mal, von diesem großen Berichtsgebiet Österreich und Südosteuropa gehst du in dieses winzig kleine Ländchen Israel. Das muss man auf der Karte mit der Lupe suchen." Natürlich hatte er recht, was die Geographie betrifft. In Bezug auf die Bedeutung für die Berichterstattung sieht es aber anders aus. Hier spielen Israel und die palästinensischen Gebiete bekanntlich eine sehr große Rolle. Und alle Medienschaffenden stehen mit ihren Beiträgen extrem unter Beobachtung. Ich würde lügen, wenn ich behauptete, dass das den Stresslevel nicht erhöht.
Außerdem musste ich mich erst an die kurzen Distanzen gewöhnen. Drehs in Südosteuropa waren ja fast immer mit längeren Anreisen und Übernachtungen verbunden. In Israel kam ich mir anfangs fast faul vor, weil ich plötzlich nach den Drehs abends wieder zu Hause war. Ein Blick auf die Sendestatistik hat mich aber schnell beruhigt. Wohl die einschneidendste Veränderung: In Südosteuropa war ich es zwar gewohnt, in Kriegs- und Krisenregionen zu fahren, manchmal sogar dort wochenlang zu wohnen, um zu berichten – etwa über den Kosovo-Krieg. Aber in Israel war ich nicht mehr als reisende Reporterin zu Besuch in einem Krisengebiet. Sondern das Krisengebiet war mein Zuhause. Das macht einen großen Unterschied.
Nach sechs Jahren in Tel Aviv sind Sie dann zum Bayerischen Rundfunk nach München zurückgekehrt. Welche Themen-Komplexe haben Sie in Ihrer Zeit im Nahen Osten besonders beschäftigt?
ARD Mediathek
Sex! Könnte man zumindest denken, weil ich mich zum Ende meiner Korrespondentinnen-Zeit an der neuen Mediathek-Reihe "Sex, Liebe und Tabu" beteiligen durfte, die in fünf verschiedenen Ländern spielt und erfreulicherweise sehr erfolgreich läuft. Meine Ko-Autorin Sophie von der Tann und ich haben in unserem Film die speziellen Beziehungs-Regeln der ultra-orthodoxen Jüdinnen und Juden dargestellt. Es hat fast ein Jahr lang gedauert, bis es gelungen ist, in diese sehr abgeschottete Community zu kommen. Darauf bin ich schon etwas stolz.
Aber jetzt im Ernst: Natürlich ist und bleibt das Hauptthema der Nahost-Konflikt. Die ständig gestellte Frage: "Frau Glass, wie sieht es mit der Zukunft der Zweistaaten-Lösung aus?", kann ich mittlerweile selbst dann in jeder gewünschten Länge beantworten, wenn man mich aus dem Tiefschlaf weckt. Ein weiterer großer Themenkomplex, der natürlich auch mit dem Konflikt verbunden ist: Religionen. Der Faszination Jerusalems als Heilige Stadt dreier monotheistischer Weltreligionen kann sich wohl kein Besucher entziehen. Generell ist aber das Schöne am Korrespondentinnen-Dasein, dass wir eine extrem breite Themenpalette in vielen verschiedenen Formaten abdecken können. Ich habe im Morgenmagazin über neue Raketenangriffe aus dem Gaza-Streifen berichtet und am Abend die deutschen Teilnehmerinnen beim Eurovision Song Contest beim Party-Hopping in Tel Aviv begleitet.
Der Nahe Osten ist politisch und historisch ein sehr spezielles Berichtsgebiet. Wie haben die vielen Konflikte Ihre Arbeit als Journalistin beeinflusst?
Ich habe in der pittoresken Altstadt von Jaffa gewohnt, mit jüdischen, arabisch-muslimischen und arabisch-christlichen Nachbarn. Dort gibt es die Kunstinstallation "Der hängende Orangenbaum." Eine Reminiszenz an die vielen (Jaffa-)Orangen-Haine, die es hier früher gab. Der Künstler hat die Wurzeln einbetoniert und den Baum etwa einen Meter über dem Boden mit Stahlseilen aufgehängt. Er wird über Schläuche bewässert und lebt weiter. Die Installation ist fester Bestandteil jeder Stadtführung. Ich habe immer gerne den Guides gelauscht.
Bei jüdischen Gruppen hieß es: "Dieser Baum symbolisiert die Entwurzelung des jüdischen Volkes bis zu seiner Rückkehr ins Land Gottes." Bei arabischen Gruppen war er dagegen "das Symbol für die Entwurzelung der Palästinenser durch Flucht und Vertreibung nach der Staatsgründung Israels". Für mich eines der besten Beispiele für die unterschiedlichen Narrative und die vollkommen verhärteten Fronten im Nahost-Konflikt. Um die Deutungshoheit wird auf allen Ebenen erbittert gekämpft.
Besonders als deutsche Journalistin muss man sich darüber im Klaren sein, dass jedes Wort eines Beitrages auf den Prüfstand gestellt wird. Berechtige Kritik nehme ich sehr ernst. Aber es passiert auch, dass unsere Aussagen absichtlich verdreht oder in falschem Kontext dargestellt werden. Es sind leider viele Fake-News und Hass im Spiel. Das kann sehr untergriffig werden. Ich kenne niemanden, der das immer souverän wegsteckt. Ich habe mir aber fest vorgenommen, davor nicht einzuknicken und nicht mit einer "Schere im Kopf" bestimmte Themen zu vermeiden.
Außerdem bin ich sehr sensibel geworden, was Überschriften betrifft. Es passiert leider immer wieder, dass etwa getitelt wird: "Israelische Sicherheitskräfte erschießen Palästinenser auf dem Tempelberg". Und erst im Text darunter erfährt man, dass der erschossene Palästinenser zuvor ein Messerattentat auf einen Israeli verübt hat. So eine irreführende Headline gilt es unbedingt zu vermeiden. Überschriften müssen klar Ursache und Auswirkung in der richtigen Relation erkennbar machen.
Israel wird immer wieder als Vergleich herangezogen, wenn es um Corona-Bekämpfung geht. Wie hat Corona das Land in der Zeit, in der sie dort waren, verändert?
Die Israelis sind an ein ständiges Leben im Krisenmodus gewöhnt. Entsprechend pragmatisch sind sie auch mit der Pandemie-Krise umgegangen: Impfstoff in großen Mengen eingekauft, auf den Datenschutz gepfiffen, die Kampagne voll digital straff organisiert und umgesetzt. Außerdem war Israel wohl eines der weltweit am stärksten abgeschotteten Länder. Da mehr als 90 Prozent der Ein- und Ausreisen über den Ben Gurion-Flughafen laufen, war die "Schließung des Staates" gut umzusetzen und zu kontrollieren. Je länger sie aber dauerte, desto mehr lagen aber bei allen im Land die Nerven blank. Dazu zähle ich ausdrücklich unser gesamtes Studio-Team inklusive mir selbst. Als die Pilgergruppen plötzlich wegblieben, war ich einmal ganz alleine in der Geburtskirche in Bethlehem und auch der Grabeskirche in Jerusalem. Wo sich sonst Besucher vergleichbar wie an einem Oktoberfest-Samstag durchdrängen.
Was war Ihr schönstes Erlebnis in Ihrer Zeit als Korrespondentin?
Ups! Das ist nach 23 Jahren in insgesamt 14 Ländern bzw. Gebieten nicht wirklich zu beantworten. Ich habe eine ganze Schatztruhe voll wunderbarer Erinnerungen und Erlebnisse. Aber prinzipiell berührt es mich immer tief, wenn Menschen zusammenfinden, die sich vorher in Feindschaft, Krieg, Hass oder Angst gegenüberstanden. Der Moment zum Beispiel, als in der bosnischen Hauptstadt Sarajewo meine serbischen, kroatischen und bosnischen Kolleginnen und Kollegen zum ersten Mal nach dem jugoslawischen Völkerkrieg ausgelassen miteinander feierten. Und sich von da an regelmäßig gegenseitig besuchten.
Oder als ich zwei jüdische Freunde mit nach Bethlehem nahm. Die beiden wollten unbedingt das Weihnachtsfest dort erleben. Alleine hätten sie sich aber nie in die palästinensischen Gebiete gewagt. Bei der Hinfahrt telefonierten sie nervös mit ihrer Familie, die offenbar Angst hatte, dass sie als Juden von den Palästinensern massakriert werden und die beiden am liebsten zur Umkehr bewegt hätte. Bei der Ankunft in Bethlehem hingen sie mir zunächst angespannt am "Rockzipfel". Dabei musste ich doch arbeiten. Dann waren sie plötzlich im Altstadt-Bazar verschwunden. Da machte ich mir Sorgen. Aber als sie beladen mit Einkäufen wieder auftauchten, waren sie hellauf begeistert von der palästinensischen Gastfreundschaft. Wie schön Bethlehem ist und wie nett die Palästinenser dort sind, wurde dann bei der Rückfahrt gleich telefonisch sämtlichen Verwandten und Bekannten mitgeteilt.
Und was hat Sie am meisten erschreckt?
Das Ausmaß von Hass, Gewalt und Zerstörung, zu dem Menschen fähig sind. Und wie schnell ein eingefrorener Konflikt in brutale, offene Aggression umschlagen kann. Auch in meiner oben beschriebenen Altstadt-Idylle in Jaffa, habe ich im vergangenen Mai während des Gaza-Krieges erlebt, wie meine arabischen und jüdischen Nachbarn plötzlich aufeinander losgegangen sind. Mein Weg vom Studio nach Hause führte an brennenden Autos vorbei und Lynchmobs zogen durch die Straßen.
Furchtbar war der Moment, als ich an einem Massengrab im Kosovo stand, wo noch Kinderhände aus der Erde ragten. Und nie vergessen werde ich auch das Gefühl bei den Live-Schalten vom Grenzzaun aus dem Gaza-Streifen, als hinter uns mehrere junge Palästinenser von der israelischen Armee erschossen wurden, weil sie dort randalierten.
Wie hat sich die langjährige Arbeit in Kriegs- und Krisengebieten auf Sie persönlich ausgewirkt?
Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, einen kühlen Kopf zu bewahren. Je stressiger und gefährlicher eine Situation, umso ruhiger sollte man selbst bleiben. Vieles relativiert sich natürlich auch, wenn man echte Not und Elend so nah miterlebt. Während meiner Zeit im Kosovo hatte ich bei "Heimat-Urlauben" absolut keine Lust auf Party-Smalltalk. Ich erinnere mich auch, dass ich mit meinem Mann im Bayerischen Wald spazieren ging und mal dringend austreten musste. Aber ich habe es mir verkniffen. Erst als wir zurück beim Auto waren, ist mir eingefallen: Meine Reflex, jede Minengefahr zu vermeiden, ist in Bayern unnötig. Hier liegen keine Sprengfallen im Wald.
Manche Situationen empfinde ich auch als grotesk. Wenn ich für einen Tagesthemen-Kommentar geschminkt werde, mit der Stylistin über eine schöne Lippenstift-Farbe diskutiere, während draußen die Sirenen heulen und gleich danach eine Rakete unweit vom Studio einschlägt. Aber ich merke jetzt: Die schlimmste Auswirkung ist offensichtlich, dass ich nicht aufhören kann, Geschichten aus dieser Zeit zu erzählen. Ich bin jedenfalls sehr dankbar darüber, dass ich sie erleben durfte.
Wie sieht Ihre neue Aufgabe beim BR aus?
Ich bin stellvertretende Redaktionsleiterin Ausland und politischer Hintergrund. Es ist schön, nach so langer Zeit draußen wieder mit den vielen tollen Kolleginnen und Kollegen im Haus zusammenzuarbeiten und jetzt mal von Innen die zukünftige Entwicklung inklusive der Bedeutung der Auslandsberichterstattung mitzugestalten.
Vielen Dank für das Interview!