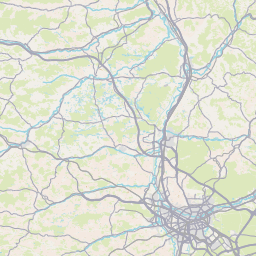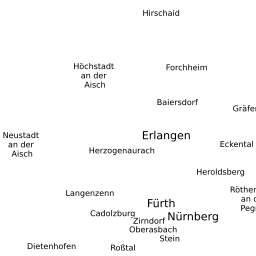Jüdisches Leben heute "Wir sind ganz normale Menschen"
Die jüdischen Gemeinden in Deutschland verzeichnen heute nur noch etwa 96.000 Mitglieder. Wie vielfältig ist das jüdische Leben heute? Und wie sieht der Alltag der Jüdinnen und Juden hierzulande aus? Vier Beispiele aus Franken.
In Bayern existierten vor 1933 beinahe zweihundert jüdische Gemeinden, die meisten davon in Mittel- und Unterfranken. Bedeutende Zusammenschlüsse gab es unter anderem in Nürnberg und Fürth, das sogar als das "fränkische Jerusalem" galt. Heute, ein dreiviertel Jahrhundert nach Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Versuch der Auslöschung der europäischen Juden durch die Shoa verzeichnen die jüdischen Gemeinden in Deutschland insgesamt nur noch knapp 100.000 Mitglieder. Dazu kommen Menschen, die nicht Mitglied einer Gemeinde sind, zwischen 30.000 und 80.000 Juden und Jüdinnen, zusammen weniger, als vor rund einhundert Jahren allein in Berlin lebten.
Nicht zuletzt aufgrund der geringen Zahl jüdischer Menschen in Deutschland heute ist es kaum erstaunlich, dass viele Nichtjuden hierzulande noch nie einen persönlichen Kontakt zu Juden und Jüdinnen hatten und daher wenig Kenntnis über das jüdische Leben besitzen. Wie soll da "Normalität" entstehen? Und wieviel "Normalität" ist überhaupt möglich, solange noch immer die alten Vorurteile bestehen?
Ruth Celanski: "Wir sind ganz normale Menschen, ganz normal."
"Das sind Vorurteile, gegen die kann man nichts machen, also wir haben nicht alle Geld, wir sind nicht alle reich, wir sind übrigens auch nicht alle klug, wir sind ganz normale Menschen, ganz normal."
Ruth Ceslanski, Christlich-jüdische Zusammenarbeit in Franken
Ruth Ceslanski wurde 1958 in Ansbach geboren. Heute lebt die Übersetzerin in Nürnberg. Natürlich steckt der Satz von der scheinbar vereinfachenden "Normalität" auch voller Ironie. Und dennoch bildet er in einer pluralen Gesellschaft wie der unseren auch die Grundlage für einen selbstverständlichen Umgang im Miteinander.

"Für mich ist das wichtig, auf diese Normalität hinzuweisen, weil wir Juden und Jüdinnen ja seit x-tausend Jahren, jedenfalls seit fast 2.000 Jahren, anders betrachtet werden. Aber abgesehen davon, dass wir anders beten und andere Traditionen haben, gehören wir wie alle anderen zur Gattung Homo sapiens. Was ich unter Normalität verstehe: dass man sich erstmal gar keine Gedanken macht. Muss das jedes Mal 'Klick' in meinem Kopf machen, um die Leute einzusortieren in irgendeine Kategorie? Es ist natürlich verständlich, warum das gemacht wird. Das ist eben Teil unserer Versuche, uns zu identifizieren als ein Teil einer Gruppe. Aber wir können das auch überwinden, es muss überwindbar sein! Und wenn wir das überwinden, dann werden wir viele Kriege nicht mehr führen müssen. Wenn man aber denkt, der andere ist minderwertig, oder ich bin minderwertig, dann werden wir immer dieses Problem haben."
Ruth Ceslanski, Christlich-jüdische Zusammenarbeit in Franken
Andrei Kovacs, der Geschäftsführer des Vereins "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" erklärte kürzlich, es sei doch eben immer noch eine schwer verkrampfte Situation, wenn man sich heute im Jahr 2021 in Deutschland als Jude oder Jüdin zu erkennen gäbe. Entweder die Leute reagierten übertrieben freundlich oder übertrieben traurig. Von einer Normalität im Umgang miteinander jedenfalls sei das sehr weit entfernt. Das kann auch Ruth Ceslanski bestätigen.
"Von da, wo ich auch selbständig denken konnte, und Eindrücke einsortieren konnte, ist es mir aufgefallen, dass man etwas Besonderes war und immer noch vielleicht ist, wenn man Jude, Jüdin in Deutschland ist. Und jetzt trifft man einen 'echten lebendigen Juden', das passiert ja auch nicht so häufig. Also wann trifft man schon einen Juden, der dann auch sagt, ach, übrigens, ich bin Jude. Und das verblüfft die Leute, die wissen dann vermutlich auch gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Sag ich, ok, du bist Jude, ich bin katholisch. So what!? Das wäre mal eine tolle Reaktion, aber das passiert ja nicht. Und die Leute sind dann entweder betroffen. Oder neugierig. Das ist natürlich schön, wenn's von Herzen kommt. Oder wir gehen dann gleich zur Israelkritik über und diskutieren da weiter. Also so was wie Normalität, wenn man sich 'outet', gibt es nicht."
Ruth Ceslanski, Christlich-jüdische Zusammenarbeit in Franken
Daniela Eisenstein: "Der persönliche Austausch fehlt."
"Ich glaube tatsächlich, dass der persönliche Austausch fehlt. Erst in den letzten Jahren ist in der Medienlandschaft zum jüdischen Leben heute einiges erschienen. Was ja auch vorgefestigte Klischees oder Bilder, die man vom 'Juden' hat, aufgebrochen hat."
Daniela Eisenstein, Leiterin Jüdisches Museum Franken
Meint die Historikerin Daniela Eisenstein, geboren 1969 in Bufallo/New York. Die gebürtige Amerikanerin leitet seit dem Jahr 2003 das Jüdische Museum Franken in Fürth, Schnaittach und Schwabach. Unbekümmert sei der Umgang zwischen Juden und Nichtjuden beileibe noch immer nicht. Und doch habe sich schon viel verändert, nicht zuletzt durch den offenen Umgang der Medien mit dem Thema.
"Ich glaube, die Lindenstraße hat ja auch schon mal ein jüdisches Thema verarbeitet. Es spiegelt sich eben in Serien wieder, in Krimis, in den Nachrichten, im Fernsehen, in der Berichterstattung, und es gibt ja auch viele Celebrities, die jüdisch sind und das auch offen sagen. So hat das eine Art Selbstverständlichkeit gewonnen, wie wir es eigentlich nur aus den USA kennen oder aus England. Das hat in den letzten Jahren in Deutschland tatsächlich gefehlt, aber ich glaube auch, dass das die Nachwirkungen der Shoa sind auf die Gesellschaft, dass es jahrzehntelang auch gewisse Berührungsängste gegeben hat. Und in den letzten Jahren hat sich mit den jüngeren Generationen der Blickwinkel etwas verändert und auch entkrampft. Natürlich kann man viel mehr über jüdisches Leben erfahren, wenn man in ein jüdisches Museum geht. Es gibt mittlerweile in Deutschland viele und auch sehr gute jüdische Museen, man muss nicht immer nach Berlin reisen um ins jüdische Museum zu gehen. Es reicht auch, nach Frankfurt oder München oder Fürth zu kommen."
Daniela Eisenstein, Leiterin Jüdisches Museum Franken
Stereotype in den Köpfen
"Den Juden werden eigentlich immer dieselben Fragen gestellt: Wie kommt es, dass Sie hier leben? Wie ist die Geschichte Ihrer Familie? Warum sind Sie hiergeblieben? Wie fühlen Sie sich heute? Und wie stehen Sie zu Israel?"
Ruth Ceslanski, Christlich-jüdische Zusammenarbeit in Franken
Resumiert hingegen Ruth Ceslanski. Womit wir eben doch wieder bei den Stereotypen wären. Vielfach ist auch die Auffassung verbreitet, dass aufgrund des erlebten Leids während der Shoa Juden heute doch bitte die besseren, klügeren und friedfertigeren Menschen zu sein hätten. Dem Argument, das gern zur Israelkritik herangezogen wird, erteilt Daniela Eisenstein eine knallharte Absage.
"Die Vernichtungslager und die Konzentrationslager waren keine Besserungsanstalten. Juden sind nicht bessere oder schlechtere Menschen als alle anderen, sie sind Menschen. Das gilt es auch anzuerkennen."
Daniela Eisenstein, Leiterin Jüdisches Museum Franken
In Krisensituationen werden Stereotype oft neu belebt, alte Feindbilder reanimiert. Die im Zuge der Corona-Pandemie aktuell mancherorts wieder aufkeimenden antijüdischen Verschwörungstheorien betrachtet Daniela Eisenstein hingegen gelassen, aber aufmerksam.
Jan Guggenheim: "Antisemitische Anfeindungen habe ich nicht erlebt."
Jan Guggenheim, geboren 1986 in Duisburg und heute Gemeinde-Rabbiner in Fürth, sagt hingegen, er habe noch keine persönlichen Erfahrungen mit Antisemitismus gemacht.
"Umgekehrt habe ich Erfahrungen, dass man mich auf der Straße sehr oft mit 'Schalom' grüßt oder wenn gerade Schabbat ist, dann mit 'Schabbat Schalom', manche sagen auch 'Schalom Schabbat'. Aber antisemitische Anfeindungen habe ich nicht erlebt."
Jan Guggenheim, Gemeinde-Rabbiner in Fürth
Was zweifellos für die Offenheit spricht, Weltoffenheit, die heute in einer Stadt wie Fürth scheinbar herrscht. Jan Guggenheims Biographie führte ihn vom Ruhrgebiet in das ehemalige "fränkische Jerusalem". Religion spielte schon in seiner Großfamilie früher eine wesentliche und inspirierende Rolle. "Pessach", das Fest, das an den Exodus, die Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei erinnert, war schon immer das "Mega-Event" bei uns, sagt Jan Guggenheim. Als Jugendlicher entschloss er sich, allein nach Israel zu gehen, besuchte dort ein religiöses Internat. Irgendwann war für ihn klar, dass er Rabbiner werden wollte. Als orthodoxer Gemeinderabbiner in Fürth ist er heute, weil es sich um eine kleine Gemeinde handelt, Vorbeter, Religionslehrer und Rabbiner in einer Person. In Franken geborene Juden gibt es in Fürth kaum noch.
"Die Gemeinde besteht aus etwa 330 Gemeindemitgliedern. Die meisten stammen aus der ehemaligen Sowjetunion. Es gibt einige junge, aber die meisten Gemeindemitglieder sind ältere Menschen, die in der Sowjetunion keine Religion kennenlernen konnten, nicht leben durften. Sie kommen sehr gern in die Gemeinde, sehr gern zum Gottesdient und auch sehr gern zum Unterricht, den ich anbiete, der wird dann immer übersetzt ins Russische."
Jan Guggenheim, Gemeinde-Rabbiner in Fürth
Für die Juden und Jüdinnen aus der ehemaligen Sowjetunion ist es ein Segen, dass sie jetzt in der Fürther Gemeinde wieder näher an ein für sie über Jahrzehnte verlorenes Judentum herangeführt werden.
Lena Prytula geht selbstbewusst mit ihrer jüdischen Identität um
"Meine Eltern sind nicht religiös. Mein Papa ist konfessionslos und meine Mama trägt auch keinen Davidstern und ist auch nicht religiös. Ich persönlich trage aber meine Davidsternkette, und ich bin ja auch sehr aktiv in der Gemeinde und in der jüdischen Jugendarbeit."
Lena Prytula
Lena Prytula ist Nürnbergerin und Jüdin, Jahrgang 2000. Sie wurde in der östlichen Ukraine geboren und gehört zu einer neuen jüdischen, zudem gesellschaftspolitisch sehr aktiven Generation. 2004 kam die Familie nach Deutschland und zog, da hier bereits ein Großonkel lebte, nach Nürnberg. Mit ihrer jüdischen Identität geht die Zwanzigjährige heute trotz vereinzelter, wenn auch beunruhigender antisemitischer Erfahrungen selbstbewusst und erfrischend offen um. Und doch war ihr Weg dorthin nicht selbstverständlich.
"Es fing an in der Grundschule. Da wurde ich von einem Jungen und seinen Freunden immer mit 'Hey, du Jude!' begrüßt. Das war so das erste Mal, dass mir Antisemitismus widerfahren ist, wobei 'Hey, du Jude' natürlich keine Beleidigung ist. Es impliziert ja, dass man irgendwie anders ist als jeder andere. Da habe ich mir gedacht, ich muss mich jetzt mit meinem Judentum auseinandersetzen und irgendwas muss damit 'falsch' sein. Irgendwas muss da einfach sein, dass ich auch lernen muss, was es heißt, jüdisch zu sein, damit ich auf Fragen entsprechend antworten und reagieren kann. Ansonsten kann ich nur sagen, dass man in der U-Bahn, Straßenbahn das natürlich schon sofort merkt, wenn man so gemustert wird und immer so hoch und runter geguckt wird auf den Davidstern und teilweise auch ein bisschen angewiderte Blicke kommen von den Leuten, also, sowas merkt man schon."
Lena Prytula
Durch ihre politische Aktivität wird sie gelegentlich auch konfrontiert mit ebenso absurden wie erschreckend unreflektierten Reaktionen.
"Wenn ich mal ein Interview gebe und es da eine Kommentarfunktion gibt, habe ich auch schon erlebt, dass Kommentare folgen wie 'Jaaa, wenn ihr Antisemitismus widerfährt, ist sie doch selber schuld!! Soll sie ihren 'Judenstern' doch nicht tragen!!!' Und sowas ist halt schon krass, da ist einem schon ein bisschen mulmig zumute."
Lena Prytula
"Meet a Jew" – offener Dialog mit Jüdinnen und Juden
Lena Prytula studiert heute in Nürnberg auf das Lehramt und ist in mehreren jüdischen Studenteninitiativen aktiv. Unter anderem arbeitet sie für das unkonventionelle Projekt "Meet a Jew", dass Nichtjuden die Gelegenheit gibt, mit Jüdinnen und Juden in einen ganz persönlichen, offenen Dialog zu treten. "Meet a Jew" ist ein Projekt des Zentralrats der Juden in Deutschland, mit dem Lena Prytula, wie sie sagt, "supertolle Erfahrungen" gemacht hat.
"Ich find‘s wirklich toll, was für interessante Fragen gestellt werden. Wirklich sehr tiefgründige und philosophische Fragen auch. Aber dann auch so Fragen wie: Was heißt das überhaupt für Dich, jüdisch zu sein? Oder: Isst Du koscher? Hältst du den Schabbat ein? Was ist der Schabbat überhaupt? Darf man sein Handy benutzen, ja oder nein? Man kommt halt gut ins Gespräch und ich finde, es ist eine supertolle Initiative, die ich wirklich nur jedem empfehlen kann, sich das einmal anzugucken. Es ist wirklich eine Herzensangelegenheit und macht auch sehr viel Spaß."
Lena Prytula
1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland
Die deutsch-jüdische Schriftstellerin Mirna Funk erklärte kürzlich, dass, wenn sie heute für Workshops in Schulen ginge und fragte, was den Schülern einfällt zu Juden oder Jüdinnen, käme als Antwort: Sechs Millionen sind tot. Und Hitler. Und KZ. Aber kein Wort über Rosch Haschana, Schabbat oder Bar-Mizwa. Und das trotz 1.700 Jahren jüdischen Lebens in Deutschland. Das sei, ihrer Meinung nach, katastrophal. Das sieht auch Lena Prytula so. Das Jubiläumsjahr "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" ist für sie eine Chance, sich mit jüdischer Gegenwart und Geschichte zu beschäftigen, nicht zuletzt deshalb, weil Juden und Nichtjuden in Deutschland über Jahrhunderte hinweg immer wieder eine Symbiose eingegangen sind.
Was ist der Mensch eigentlich?
Jüdischsein bedeutet ganz "normale Vielfalt". Und das kann auch einfach eine geistige Haltung zur Welt sein, eine Betrachtung zum Verhältnis von Mehrheit und Minderheit. Und vielleicht leitet das Jüdischsein gerade durch die Zuschreibungen, die es so oft erfahren hat, einfach hin zur Reflexion, zur Gesellschaftsanalyse, vor allem aber auch zu der Frage danach, was der Mensch eigentlich ist.