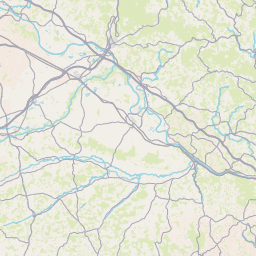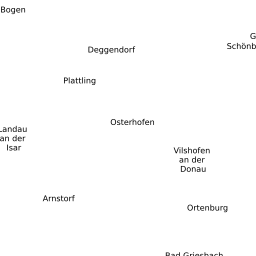Das Corona-Tagebuch Darf es mir gut gehen, wenn es anderen so schlecht geht?
Nass, grau, kalt - das kann einen schon zu normalen Zeiten in die Depression treiben. Die Corona-Situation setzt da noch einen drauf. Um dem zu entkommen, ist Dorjee Lhamo Gerhard – unsere neue Host bei Workin’ Germany – zu ihrer Familie nach Nepal gezogen. Sie kann dort das Leben wieder genießen. Nur das schlechte Gewissen ihren deutschen Freund*innen gegenüber wird sie nicht los.

Es ist 05.30 Uhr morgens, Irrtum unmöglich. Die melodisch-raue Stimme meines Großvaters dringt durch meine Tür. Wie jeden Morgen lausche ich auch heute seinen Gesängen, die mich zurück in den Schlaf wiegen. Heilige Worte füllen den Raum in einer Sprache, die mir bekannt und fremd zugleich ist. Zusammen mit den tibetischen Gebetsfahnen, dem leisen Rascheln der alten Schriften und dem Bewegen der Gebetsperlen nach jedem Mantra entsteht eine Symphonie. Eine Symphonie, die ich nur als Frieden auf Erden bezeichnen kann. Als ich das nächste Mal aufwache, ist mein Großvater weg - und mit ihm sein beruhigender Gesang. Nun ist es an mir, meinen Tag zu starten und selten fiel mir das so leicht wie hier in Kathmandu, Nepal.
Einfach aufstehen und meinen Tag beginnen ist etwas, das mir vor drei Monaten noch unmöglich erschien. Auf dem Höhepunkt meiner 2020-Depression, die sich so wunderbar mit der Wintermelancholie vermischt hat, war mentale Stabilität ein undenkbarer Traum. Der Sturm, der in mir tobte, hatte nur eine Nachricht: Du musst hier weg, du gehst kaputt. Die Ursachen für meinen Zustand? Wie bei den meisten Leuten, denen es gerade ähnlich geht, sind es viele.
Wir sind alle nach Nepal gekommen, nur du fehlst
Täglich suchte ich nach Lösungen für meinen eskapistischen Drang bis mich die Nachricht meiner Tante erreichte: „Wir sind alle aus Kanada nach Nepal gekommen, nur du fehlst.“ Auch Kanada hatte aufgrund der Pandemie komplett dichtgemacht, doch sobald es möglich war, flog ein Teil der Familie zurück zum anderen Teil, um in Nepal den Lockdown abzusitzen. Täglich aktualisierte ich die Webseite des Auswärtigen Amtes und als es endlich keine Reisewarnung mehr gab, saß ich keine Woche später im Flugzeug. Seit Mitte Januar bin ich nun in Kathmandu und diese Reise ist nicht nur eine physische, sondern auch eine psychische.
Seit ich in Nepal bin, hat sich mein mentaler Zustand komplett transformiert: Mein innerer Sturm hat sich gelegt, ich fühle mich wie befreit und bin erleichtert, dem düsteren Hamburg entkommen zu sein. Ich empfinde tiefe Dankbarkeit. Dankbar, mich komplett auf mich konzentrieren zu können und auch körperlich weg zu sein – weg von den Problemen anderer. Aber kaum gefühlt, macht sich sofort schlechtes Gewissen breit: Darf es mir so gut gehen, wenn es anderen so schlecht geht?
Darf man als Aktivistin zufrieden sein?
Als Buddhistin gab es nichts Schöneres als zu spüren, wie ich endlich mit mir Kontakt trete. Ich bin aber auch Aktivistin und trotz „Urlaub“ stehen für mich die Anliegen aus meiner Arbeit als Aufklärerin im Bereich Anti-Diskriminierung nicht still. Als Aktivistin fällt es mir besonders schwer, einfach zufrieden zu sein mit dem Leben, das ich hier führen darf. Rund um mich herum scheint die Welt weiter zu brennen, aber Nepal... Nepal ist wie eine Parallelwelt. Natürlich gibt es hier auch Rassismus und viele Probleme, aber andere, fernab der westlichen Welt. Probleme, die mich in meiner Privilegiertheit – auch hier – einfach nicht betreffen. Gut situiert genieße ich hier ein sicheres Leben, wirtschaftlich und sozial gesehen. Rückblickend kommt mir mein Leben in Hamburg wie ein Kampf ums Überleben vor. Kein direkter Halt in der Familie, keine finanzielle Sicherheit und erst recht keine Ruhe.
So bin ich nun hier und fühle mich so gut wie schon lange nicht mehr - und fühle mich gleichzeitig schlecht. Während die Nachrichten meiner Freund*innen an mich dringen, weiß ich, dass ich für sie da sein sollte. Dass dort Menschen sind, die mich brauchen und die auch ich emotional brauche. Eine andere Familie, die ich gerade im Stich lasse. Selten ist mir so bewusstgeworden, in wie vielen Welten gleichzeitig ich leben muss. Wie ich Asiatisch und Westlich sein jongliere und wenn ich mich für eines entscheide, ein schlechtes Gewissen habe, das andere zu vernachlässigen. Ich möchte die eine Welt auf „Pause“ setzen, mich komplett immersieren und erst dann wieder auf „Start“ drücken, wenn ich bereit bin - und nicht dann, wenn die Umstände um mich herum ein „Fortsetzen“ erzwingen.
Eine Auseinandersetzung mit den Wurzeln
So schön es ist, genauso schwierig ist eine Auseinandersetzung mit den Wurzeln. Durch die Corona-Pandemie habe ich eine Chance wie nie zuvor bekommen: Als ich das letzte Mal so lange bei meiner tibetischen Familie verweilen konnte, war ich wahrscheinlich fünf Jahre alt. Je länger ich hier bin, desto mehr spüre ich, wie sich beim Gedanken an die Rückkehr eine schleichende Angst breitmacht. Das Leben hier ist so intensiv, ich würde es gar als sinnlich beschreiben. Dabei frage ich mich, ob ich romantisiere oder ob ich hier einfach im Moment leben darf, und deshalb wahrnehme, was ich in Hamburg nicht tue.
Denke ich an Hamburg sehe ich nur einen Schleier, teils der Depression geschuldet, teils dem Fakt, dass dort für mich ein „Leben im Moment“ mit so viel Unzufriedenheit verbunden war. Ohne ein Gerät mit Zugang zum Internet konnte ich kaum atmen. Ich habe Angst vor den Menschen, die, wenn auch zurecht, angespannt sind wegen der Corona-Situation. Ich habe Angst vor anti-asiatischem Rassismus, und ich habe Angst mein Gleichgewicht wieder zu verlieren. Was nun tun mit diesen Befürchtungen?
Im Moment Stärke zu finden
Auch der Weihrauch, der meine Nase kitzelt, die Sonnenstrahlen, die meine Haut wärmen, die Butterlampen, die in Einheit brennen oder die zeremoniellen Trommeln, die vom Kloster bis hierher dringen, sind keine Lösung. Aber sie helfen mir zurück ins Hier und Jetzt zu finden: Die Gedanken an die Zukunft los zu lassen, im Moment Stärke zu finden, das Lächeln auf meinem Gesicht zu spüren und die Empathie, die ich für meine Umwelt habe, auch für mich zu empfinden. Wenn ich jetzt noch realisiere, dass ich mir die Geborgenheit, die ich hier fühle, selbst geben kann, wird meine Rückkehr nach Deutschland nicht mehr mit Ängsten verbunden sein. Mal schauen, wie viel Zeit in Nepal ich dafür noch brauche...