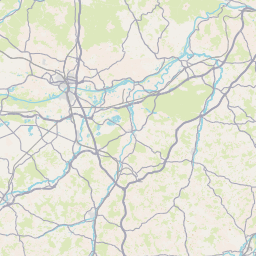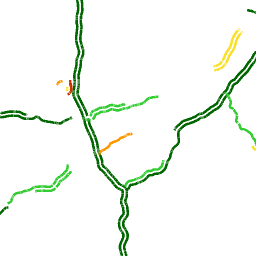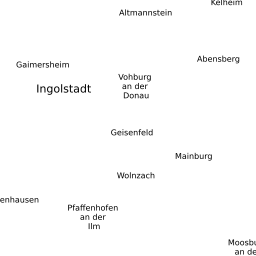Psychoneuroimmunologie Wie Stress das Immunsystem beeinflusst
Die Psychoneuroimmunologie erforscht, wo die Schnittstellen von Gehirn und Immunsystem liegen und auf welchem Weg Stress unseren Körper beeinflusst. Sie baut eine Brücke zwischen Labor-Medizin und Psychologie.

Psychoneuroimmunologie ist ein relativ junges, interdisziplinäres Forschungsfeld, das sich mit den Wechselwirkungen zwischen Psyche, Nerven- und Immunsystem auseinandersetzt. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den Auswirkungen von Stress auf die menschliche Gesundheit. Die Psychoneuroimmunologie bildet eine Schnittstelle von Fachdisziplinen wie Psychologie, Psychosomatik, Neuroendokrinologie und Immunologie, sowie somatischen Fächern wie Dermatologie oder Onkologie.
Expertin:
Prof. Dr. Eva Peters, Leiterin des Psychoneuroimmunologie Labors des Universitätsklinikums Gießen und Leiterin der Arbeitsgruppe "Psychoneuroimmunologie der Haut" an der Charité Berlin
Gesundheit ist aus Sicht der Psychoneuroimmunologie etwas sehr Individuelles: Gesund ist, wer die verschiedenen Belastungen des Alltags gut ausbalancieren kann. Dabei kann man sich aus Sicht der Psychoneuroimmunologie auch mit Bewegungseinschränkungen, Diabetes oder einer anderen Erkrankung gut einrichten.
Der Text basiert auf einem Interview mit Prof. Dr. Eva Peters, Leiterin des Psychoneuroimmunologie Labors der Justus-Liebig-Universität Gießen und Leiterin der Arbeitsgruppe "Psychoneuroimmunologie der Haut" an der Charité Berlin.
Die Psychoneuroimmunologie baut auf dem Stress-Konzept auf, das der Biochemiker Hans Selye 1950 zum ersten Mal veröffentlicht hat. In Experimenten mit dem damals neu entdeckten Hormon Cortisol fand Selye heraus, dass der Körper mit einem bestimmten Reaktionsmuster auf Stress reagiert.
"Wenn eine Anforderung da ist, die es erforderlich macht, dass wir uns verändern, dass wir darauf reagieren, damit wir diese Anforderung auch bewältigen können – dann ist Cortisol immer ein Botenstoff, der ausgeschüttet wird. Deswegen ist Cortisol auch das Erste, was den Leuten durch den Kopf geht, wenn wir Stress sagen. Denn das ist quasi synchron entdeckt und beschrieben worden."
Prof. Dr. Eva Peters
In den 1960er Jahren fand man dann heraus, dass die Stressantwort nicht nur ein adaptives Reaktionsmuster auf bestimmte Herausforderungen darstellt, sondern dass diese Antwort des Körpers auch in Schieflage geraten oder regelrecht entgleisen kann. Wenn das passiert, so zeigte sich, steigt die Anfälligkeit für Krankheiten.
"Die Experimente, die seit den späten 1960er Jahren durchgeführt wurden, sind in Covid-19-Zeiten besonders spannend, denn sie drehten sich zunächst um Viren, die Atemwegserkrankungen auslösen. Man hat im Tierexperiment gesehen: Wenn man zum Beispiel Mäuse jeden Tag in ein Röhrchen einsperrt und mit Lärm belästigt, und das ein paar Tage hintereinander tut, dann entwickeln sie viel schneller und heftiger Virusinfektionen."
Prof. Dr. Eva Peters
Etwas später wurde dieser Zusammenhang auch an Menschen untersucht. Anfang der 1970er Jahre setzten Forscher gesunde Versuchspersonen Viren aus, die Erkältungskrankheiten verursachen. Anschließend wurden sie mit umfangreichen medizinischen Untersuchungen konfrontiert.
"Man hat festgestellt: Je gestresster die Versuchspersonen waren, desto schneller und heftiger haben sie die Virusinfektion entwickelt. Es ist natürlich heute ethisch schwer zu vertreten, jemanden absichtlich krank zu machen und noch dazu dafür zu sorgen, dass er noch schlimmer krank wird. Aber das ist damals ein bahnbrechendes Experiment gewesen, das uns gezeigt hat: Forschungsergebnisse können aus dem Tierexperiment gelernt und auf Menschen angewandt werden. Und sie zeigen, dass intensiver Stress anfälliger für Infektionen und letztlich krank machen kann. Seit dieser Zeit wird der Zusammenhang zunehmend systematisch wissenschaftlich untersucht."
Prof. Dr. Eva Peters
Stress ist ein universelles Reaktionsmuster zum Schutz des Körpers, das durch Reize wie Lärm, Schmutz, Keime, aber auch durch Zeitnot oder sorgenvolle Gedanken ausgelöst werden kann. Stresszustände können akut sein wie beispielsweise bei einem Fahrradunfall, aber auch über einen längeren Zeitraum andauern.
Der Psychiater und Verhaltensbiologe George F. Solomon formulierte in den 1960er Jahren als Erster, dass Botenstoffe, die unter Stress ausgeschüttet werden, die Funktionsweise des Immunsystems verändern und damit für Erkrankungen wie Infekte, Autoimmunerkrankungen oder Krebs eine Rolle spielen können.
"Zu diesen Botenstoffen zählen Hormone wie Cortisol, Noradrenalin und Adrenalin, aber auch sogenannte Neurotrophine sowie Neuropeptide, die in sensorischen Nervenfasern zu finden sind. Zellen des Immunsystems haben zumeist mehrere Rezeptoren für Stress-Botenstoffe. Das heißt: Unser Immunsystem reagiert direkt sowohl auf Hormone als auch auf Botenstoffe aus dem Nervensystem, wenn wir Stress haben."
Prof. Dr. Eva Peters
Dass in Belastungssituationen Botenstoffe produziert werden, ist dabei zunächst eine sinnvolle Einrichtung. Doch Stress kann auch bedeuten, dass der Körper mit Verletzungen oder bisher unbekannten Erregern konfrontiert ist. In diesen Fällen muss das Immunsystem Reparatur- und Aufräumarbeiten vornehmen.
"Eine Stressreaktion ist verbunden mit einer Habacht-Stellung der Abwehrkräfte. Das bedeutet nicht nur Kampfes-Laune im Kopf, sondern auch im Immunsystem. Auf diese Weise können neue Keime, die in den Körper eindringen, schnell eliminiert werden."
Prof. Dr. Eva Peters
Muss sich der Körper mit zu vielen Keimen oder anderen Stressreizen auf einmal auseinandersetzen, kann es zu einer überschießenden akuten Stress- und Immunreaktion kommen. Fachleute sprechen im Extremfall von einem sogenannten Zytokinsturm. Zytokine sind Botenstoffe, die bei einer Immunreaktion gebildet werden und die die Entzündungsprozesse koordinieren. Man kann sich einen Zytokinsturm also als eine Art übermäßige Entzündungsreaktion vorstellen.
"Die Stressreaktion kann aber auch im anderen Extrem entgleisen – und zwar dann, wenn die Immunantwort nicht mehr das volle Programm ablaufen lassen kann. Das kann zum Beispiel unter chronischem Stress der Fall sein. In diesem Moment ist der Körper schlecht geschützt gegen neue Keime und es kann passieren, dass das Immunsystem sehr einseitig antwortet und Autoimmunreaktionen, also Fehlleistungen des Immunsystems, häufiger auftreten."
Prof. Dr. Eva Peters
Aus Sicht der Psychoneuroimmunologie sind besonders Krankheiten interessant, bei denen Stress-, Immun- und Entzündungsreaktionen so in Verbindung stehen, dass ihr Zusammenwirken chronische Erkrankungen deutlich verschlechtern, in Einzelfällen auch auslösen kann. Bekannte Beispiele sind Infektionskrankheiten wie die Tuberkulose, rheumatische Erkrankungen, Herzkreislauferkrankungen, metabolische Erkrankungen wie Diabetes, Erkrankungen des Magendarm-Trakts oder der Haut.
Den Stress an sich gibt es nicht. Vielmehr existieren verschiedene Arten von Stress, die von vielen unterschiedlichen Stressreizen ausgelöst werden können.
"Ein Stressreiz kann akut sein und schnell wieder abklingen. Wenn Sie dagegen verschiedene Stressreize immer zu dicht nebeneinander haben und keine Erholungspause dazwischen, dann ist klar, dass sich chronischer Stress entwickeln kann. Allerdings sind die Übergänge vom akuten zum chronischen Stress, vom kurzen Schreck zur Dauerangst sozusagen, oft fließend."
Prof. Dr. Eva Peters
Ab wann man von chronischem Stress spricht, lässt sich also nicht pauschal beantworten. Daher sollte immer im Einzelfall betrachtet werden: Welche Stressreize lösen welche Reaktion beziehungsweise welche Symptome im Körper aus?
Eine akute Stressreaktion äußert sich häufig durch Herzklopfen, einen starken Muskeltonus und eine erhöhte Körpertemperatur. Die Aufmerksamkeit ist gerichtet, das heißt: Man nimmt vor allem Dinge wahr, die in der Stresssituation wesentlich sind, zum Beispiel die Autotür, die sich plötzlich öffnet. Diese Stressreaktion ist zeitlich begrenzt und meist nach Minuten bis zu einer Stunde vorbei.
"Das Herzklopfen kommt von der erhöhten Adrenalin-Ausschüttung und wenn Sie genau nachdenken: Was haben die Leute um Sie herum gesagt in so einem Schreckmoment? Dann erinnern Sie sich wahrscheinlich weniger an die Worte als an das, was Sie gesehen oder gefühlt haben. Das ist die hohe Cortisol-Ausschüttung – die macht diese blitzlichtartigen Erinnerungen, wo sich alles scharf einbrennt, aber nichts Kognitives mehr möglich ist. Das heißt, unter hochakutem Stress können Sie manche Leistung nicht mehr gut abrufen."
Prof. Dr. Eva Peters
Chronischer Stress auf der anderen Seite zeigt sich eher als Erschöpfung, Gereiztheit, Schlaf- oder Konzentrationsstörungen. Auch das Langzeitgedächtnis funktioniert weniger gut. Betroffene beschreiben zudem manchmal eine größere Empfindsamkeit gegen über Schmerz- oder Juckreizen oder ein Gefühl, als würde sich eine Entzündung anbahnen.
"Das alles sind Zeichen des chronischen Stresses. Sie spüren die Erschöpfung – das ist der Cortisol-Rhythmus, der nicht mehr zwischen Akut- und Entspannungsphase wechseln kann, sondern in der Dauererhöhung drin ist. Sie merken, die Entzündungslevel im Körper steigen insgesamt. Wenn wir eine Grippe haben, wollen wir nicht umsonst ins Bett. Das nennt sich Krankheitsverhalten. Es sind Zytokine, die uns ins Bett treiben und der Körper sagt: Jetzt lieber Ruhe, damit ich regenerieren kann."
Prof. Dr. Eva Peters
Die Psychoneuroimmunologie nimmt in den Blick, welche Arten von Entzündungsreaktionen bestimmte Krankheiten hervorrufen. Das kann von Erkrankung zu Erkrankung variieren. Der Unterschied zwischen akuter und chronischer Stressreaktion wird deutlich, wenn man beispielsweise die beiden Hauterkrankungen chronisches Ekzem (Neurodermitis) und Schuppenflechte (Psoriasis) genauer betrachtet.
Im Gegensatz dazu sind bei der Entstehung einer Schuppenflechte Zellen an Entzündungsreaktionen beteiligt, die der angeborenen Immunabwehr angehören. Hier sind Zytokine am Werk, die unter akutem Stress ausgeschüttet werden – wie der Tumornekrosefaktor-Alpha oder das Interleukin 17.
"Es ist immer interessant, zu gucken: Was treibt die jeweilige Entzündung an? Was treibt das jeweilige Krankheitsbild an? Und dann findet man meistens auch die Stress-Trigger, die dafür ungünstig sind."
Prof. Dr. Eva Peters
Die Psychoneuroimmunologie ist ein eher wissenschaftlich orientiertes Fach, das im Klinikalltag noch kaum angekommen ist. Es gibt bisher keinen Facharzt für Psychoneuroimmunologie. Die Psychosomatik ist dagegen ein klinisches Anwendungsfach, das therapeutische Maßnahmen nutzt, um Patientinnen und Patienten zu helfen, zu einem lebenswerten seelischen und körperlichen Zustand zu finden.
"In der Psychosomatik hat man gesehen: Psychische Belastungszustände und körperliche oder psychische Erkrankungen sind gut erklärbar über die Interaktion zwischen Seele und Körper. Aber die Immunologie wird dabei häufig nicht berücksichtigt, weil die Begründer der Psychosomatik vorwiegend Internisten waren und sich lange nicht mit der Immunologie auseinandergesetzt haben."
Prof. Dr. Eva Peters
Um den Zustand einer Person bewerten zu können, arbeiten Psychosomatik und Psychoneuroimmunologie mit einer Kombination aus Laborwerten und einem ausführlichen Anamnesegespräch, in dem physische, psychische, aber auch soziale Gesichtspunkte eine Rolle spielen. Diese Aspekte werden sowohl im Kontext von Beginn und Verlauf der körperlichen Erkrankung als auch im Zusammenhang mit der Biographie des Einzelnen betrachtet.
"Ich kann alles Mögliche im Labor analysieren, aber es gibt keine guten Normwerte dafür, ob ein molekular-toxischer Stress vorliegt. Lieschen Müller hat vielleicht einen komplett anderen Cortisol-Wert als Fritz Maier. Aber für beide ist es jeweils das Normallevel. Das heißt, da muss ich eigentlich von derselben Person unter verschiedenen Bedingungen mehrfach gemessen haben, um sagen zu können: Für diese Person ist das ein pathologischer Wert."
Prof. Dr. Eva Peters
Über einen längeren Zeitraum lässt sich durch mehrfache Untersuchungen durchaus ein gewisses Stress-Reaktionsmuster für eine bestimmte Person ermitteln. Aber die Laborwerte müssen immer im Zusammenspiel mit dem individuellen Befinden der Patientinnen und Patienten analysiert werden.
"Wir sind so daran gewöhnt, dass man in der Medizin auf einen Apparat drückt oder Blutwerte bestimmt. Aber de facto kennen wir viele Krankheitszustände, bei denen die Laborwerte nicht besonders aussagekräftig sind und eine gute Anamnese einen deutlich weiterbringt. Nehmen wir zum Beispiel Allergien. Sie können einen sehr hohen IgE-Wert im Blut haben, also Antikörper gegen ein Allergen. Trotzdem ist es möglich, dass Sie das Obst vertragen, in dem dieses Antigen vorkommt. Der Laborwert und das persönliche Erleben stimmen hier nicht immer überein."
Prof. Dr. Eva Peters
Grundsätzlich tut es dem Immunsystem gut, wenn man sich regelmäßig bewegt, ausreichend schläft und sich gesund ernährt. Aus psychoneuroimmunologischer Perspektive ist es darüber hinaus aber auch förderlich, Selbstbeobachtung und Selbstwahrnehmung zu trainieren und zu lernen, welche Symptome eine nahende Überlastung anzeigen, um dann entsprechend reagieren zu können.
"Wo habe ich eigentlich Stressreize oder in welchem Zusammenhang werde ich wie krank? Und wie kann ich mir merken, was mich in den Stress führt und wie kann ich das frühzeitig abstellen?"
Prof. Dr. Eva Peters
Zahlreiche Untersuchungen haben gezeigt, dass das regelmäßige Praktizieren von Entspannungsverfahren eine positive Wirkung auf die Abwehrkräfte des Körpers hat. Ob man Yoga, autogenes Training oder Progressive Muskelentspannung macht, ist dabei weniger wichtig.
"Es gibt zu vielen Entspannungstechniken Studien, die zeigen: Wenn Sie das ausreichend oft trainieren, um Entspannung körperlich spürbar ankommen zu lassen, wird das Immunsystem wieder in eine homöostatische Arbeitsweise zurücküberführt. Es ist dann also wieder in der Lage, flexibel auf verschiedene Herausforderungen einzugehen. Das scheint aber eine Dosis-Wirkungs-Sache zu sein: Je besser Sie Entspannungstraining gelernt haben, desto eher wirkt es, wenn es regelmäßig angewendet wird."
Prof. Dr. Eva Peters
Allerdings: Nicht auf jeden Stress ist Entspannung die stimmige Antwort. Manchmal braucht es auch die richtige Aktivität, die einen ablenkt, auf neue Gedanken bringt oder den Selbstwert stärkt.
"Sich ins Bett zu legen und auszuruhen ist nicht in jeder Stresssituation hilfreich. Hier wird es eben wichtig, sich selbst zu beobachten. Sich in dem Moment, wo man merkt, da ist etwas in Schieflage geraten, zu fragen: Was ist das, was aus der Balance gekommen ist? Und was braucht es, damit das wieder ins Lot kommt? Das ist glaube ich das Wichtigste, denn sonst gerät man eher in Entspannungsstress."
Prof. Dr. Eva Peters
Je komplexer und schwerwiegender die psychische Belastung allerdings ist, desto weniger reichen Entspannungsmethoden alleine aus, um das Immunsystem wieder ins Gleichgewicht zu bringen. In diesen Fällen kann Psychotherapie helfen. Eine Metaanalyse aus dem Jahr 2020, die die Ergebnisse mehrerer Studien zusammenfasst, konnte zeigen, dass Psychotherapie immunologisch wirksam ist und Fehlfunktionen des Immunsystems ausbalancieren kann.
"Aber da beginnt die Forschung eigentlich erst zu verstehen. Es sind relativ viele Studien auf dem Gebiet der Verhaltenstherapie gemacht worden. Verhaltenstherapie, das sind ja oft Kurzzeit-Therapie-Programme mit rund 20 Sitzungen. Da sind vergleichende Studien schnell gemacht. Im Schnitt kann man sagen: Verhaltenstherapie wirkt, wenn es um die Immunologie geht, aber es gibt Luft nach oben. Wieviel und welche Therapie zum Beispiel braucht welcher Patient oder welche Patientin?"
Prof. Dr. Eva Peters
Neben der Verhaltenstherapie werden in Deutschland auch die sogenannte Systemische Psychotherapie, die sich vor allem auf den sozialen Kontext konzentriert, oder psychodynamische Therapieverfahren wie die Psychoanalyse und die tiefenpsychologische Psychotherapie von den gesetzlichen Krankgenkassen übernommen. Zu diesen Verfahren gibt es bislang jedoch kaum wissenschaftliche Untersuchungen.
"Da geht es oftmals um Therapien mit 50 Sitzungen und mehr. Vergleichende Studien sind hier deutlich schwieriger. Das wird schon richtig komplex. Es gibt auch relativ wenig Geld für solche Langzeitstudien. Da muss sich in der Zukunft noch so einiges tun, damit wir klinisch bewährte Behandlungen auch richtig bewerten können hinsichtlich ihrer psychoneuroimmunologischen Effekte."
Prof. Dr. Eva Peters
Grundsätzlich geht die Psychoneuroimmunologie davon aus, dass psychotherapeutische Verfahren Menschen helfen, ihre persönlichen Stressreaktionsmuster besser zu erkennen und rechtszeitig gegenzusteuern.
"Wir sehen oft am Symptom: Etwas stimmt nicht, aber wir verstehen nicht was. Wenn man beispielsweise denkt: Ich habe keinen Ausweg, es kann gar nicht anders sein. Das sind sogenannte ‚negative Kognitionen’, wenn wir verhaltenstherapeutisch denken, oder ‚negative Emotionen’, wenn wir tiefenpsychologisch denken. Das sind Kreisläufe, aus denen man alleine oft nicht ganz so gut rauskommt wie mit Unterstützung."
Prof. Dr. Eva Peters
Seit den 1970er Jahren haben zahlreiche Studien belegt, dass sich Belastungssituationen negativ auf die Wundheilung auswirken. In einer Studie haben amerikanisch Forscher beispielsweise Studenten eine Wunde im Mund zugefügt und anschließend untersucht, wie die Wunde in den Semesterferien einerseits und unter Prüfungsstress andererseits verheilt ist. Das Ergebnis zeigte klar, dass die Wundheilung im entspannten Zustand schneller und effektiver war. Dabei beeinträchtigt gerade chronischer Stress den Heilungsprozess.
"Die Nervenfasern in der Haut zeigen unter chronischem Stress ein anderes Muster, das die Wundheilung nicht gut unterstützt. Das hat etwas mit den Fresszellen zu tun, die den Dreck aufräumen in der Wunde und die unter chronischem Stress nicht so gut arbeiten."
Prof. Dr. Eva Peters
Egal ob man sich anstößt, dehnt oder die Muskulatur stark fordert – ständig reißen im Körper Blutgefäße ein oder Zellen bekommen zu wenig Sauerstoff und gehen unter. Für alle Prozesse, bei denen es um die Regeneration von Gewebe geht, ist das Immunsystem zuständig. Unter Stress funktionieren sie weniger effektiv. Auch wie gut eine Operationswunde verheilt, hängt unter anderem damit zusammen, wie ausgeglichen oder angespannt der Patient oder die Patientin ist.
"Ein guter Narkosearzt kann Ihnen vor der Operation sagen, bei wem die Wunde schnell heilen wird und bei wem nicht. Anästhesisten bekommen genau mit, ob jemand vor einer OP sehr aufgeregt und gestresst ist. Denn wenn das der Fall ist, braucht er mehr Narkotika. Und dann sehen sie hinterher, ob die Wundheilung innerhalb der üblichen zehn Tage stattfindet oder auch länger dauert."
Prof. Dr. Eva Peters
Täglich bildet der menschliche Körper etwa 10.000 Krebszellen. Das Immunsystem ist ständig damit beschäftigt, diese entarteten Zellen zu finden und zu eliminieren. Chronischer Stress trägt unter anderem dazu bei, dass dieser Aufräumprozess weniger gut funktioniert. Das heißt: Am Anfang einer Krebserkrankung kann Stress eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielen.
"Insofern als chronischer Stress die Entwicklung von Tumoren begünstigt. Stress trägt ein Stück weit dazu bei, dass das Immunsystem manchmal blind ist für Krebszellen und sie sich dann eben teilen können. Aber wenn Sie den Krebs schon haben, ist das längst passiert. Falls der Stress bei Ihnen tatsächlich eine Rolle gespielt hat und es nicht einfach der dumme Zufall war oder das Sonnenlicht, dem Sie in Ihrem Leben ausgesetzt waren. Dann ist das nicht mehr zu ändern."
Prof. Dr. Eva Peters
Ab einer bestimmten Menge von Tumorzellen kann das Immunsystem nicht mehr allein mit dem Krebs fertig werden. Dann braucht es Behandlungen wie Operation, Bestrahlung oder Chemotherapie.
"Auch nach einer Krebsoperation muss die Wunde heilen. Eine kräftige Chemotherapie bedeutet immer viel Schaden im Körper – danach muss unheimlich viel aufgeräumt werden. Da brauchen wir dann wieder unser Immunsystem. Und wenn unsere Abwehrkräfte vor lauter Angst völlig in den Knien sind, ist das für den Heilungsprozess nicht gerade günstig. Dann kann die Psychoonkologie eine wunderbare Unterstützung sein."
Prof. Dr. Eva Peters
Psychoonkologen sprechen mit Krebspatientinnen und -patienten über ihre Sorgen und Ängste, aber auch über Belastungssituationen in der Familie oder im Job. So kann der Stress, den die Krankheitsphase mit sich bringt, im besten Fall reduziert werden.