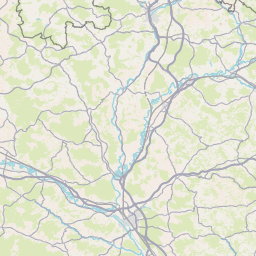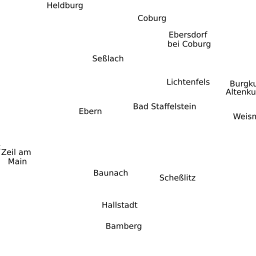Schriftsteller Navid Kermani Unser Interesse an der Welt hat spürbar nachgelassen
Wir verschließen immer mehr die Augen angesichts der Krisen der Gegenwart. Eine besorgniserregende Entwicklung, argumentiert Navid Kermani. Er sieht darin auch eine Folge der globalen Zäsur von 1989. Europa muss aktiver werden.

Anfang des Monats hielt Navid Kermani – Schriftsteller, Publizist und Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels – eine Festrede zum 75. Jahrestag Gründung des Landes Niedersachsen. Er nutzte die Gelegenheit, um über das augenblickliche außenpolitische Desinteresse zu sprechen. Die Situation in Afghanistan – eben noch das große Thema in den Nachrichten – treibe jetzt niemanden mehr in der deutschen Politik ernsthaft um. Ebenso haben wir Wahlkämpfe erlebt, in denen außenpolitische Fragen keine Rolle spielten. Ein Gespräch über einen veränderten Blick auf die Welt und das Potential von Kunst und Literatur für die Demokratie.
Marie Schoeß: Woran liegt, aus Ihrer Sicht, das Desinteresse gegenüber dem, was außerhalb Deutschlands, außerhalb Europas stattfindet?
Navid Kermani: Zum einen ist es eine Entwicklung, die man in der ganzen Welt beobachten kann. Die Globalisierung betrifft insbesondere die Mittelschichten, diejenigen, bei denen sich die Lebensverhältnisse und Lebensmodelle immer mehr angleichen – und die zugleich immer provinzieller werden, oft auch nationalistischer. Obwohl wir gleichzeitig immer enger verflochten sind mit der Welt und eben nicht nur in Deutschland das eigene immer wichtiger wird, vielleicht auch als Gegenreaktion.
Zugleich ist es auch ein spezifisch deutsches Phänomen. Ich habe seit kurzem ein Smartphone. Wenn Sie da die ARD-App und die BBC-App nebeneinanderstellen, dann leben sie in zwei verschiedenen Welten. Es ist auffällig, dass gerade auch in Deutschland die Welt in den Nachrichten und Talkshows eigentlich nur noch bei Explosionen vorkommt. Und eigentlich kann sich ein Land wie Deutschland schon aus eigenem Interesse das nicht leisten. Woran das liegt? Das eine Frage, die auch eher an Sie gerichtet ist, an die Medien. Vielleicht ist es auch eine Mentalitätsfrage. Ich kann es nicht genau sagen. Das Phänomen ist schon sehr auffällig.
Wann hat sich das gedreht? Sie weisen zurecht darauf hin, dass die Zeiten noch gar nicht so lange her sind, dass das Amt des Außenministers eines der wichtigsten, auch eines der sichtbarsten in Deutschland war?
Ich kann keine wissenschaftlich erhärtete These formulieren. Aber ich glaube, das ist eine Entwicklung, die eigentlich 1989 begonnen hat. Das Desinteresse an der Welt – quasi mit dem Sieg des Kapitalismus – hat eine Art von Rückschau und Eigenschau ausgelöst. 2001 ist die Welt noch einmal gewaltsam in unser Bewusstsein vorgedrungen. Die fortlaufenden Kriege danach haben dann aber dazu geführt – weil sie nicht erfolgreich waren, weil sie in Desastern und Demütigungen endeten –, dass das Interesse dann wieder sehr schnell nachgelassen hat.
Ich bin sehr entsetzt über diese Entwicklung. Ich will Ihnen ein konkretes Beispiel nennen: 2015, da war die Welt bei uns. Sie kam mit realen Menschen zu uns – eine Million Flüchtlingen innerhalb von sechs Monaten. Diese Flüchtlinge waren aber schon jahrelang unterwegs. Die Flüchtlingslager waren sichtbar. Es gab all die Forderungen, dass man etwas tun muss. Und wir warten so lange, bis es dann wirklich buchstäblich vor unserer eigenen Haustür ist. Und jetzt in Afghanistan wieder genauso. Auch diese Entwicklung war über Monate, wenn nicht spätestens seit dem Abkommen der USA mit den Taliban für jeden absehbar. Nicht im Detail, aber jeder hat vorausgesagt, dass ungefähr so etwas passieren wird. Nicht nur wir als Gesellschaft, auch die Medien, auch die Politik sind vollkommen unvorbereitet. Und das ist eben nicht nur eine Frage, dass unsere Empathie-Fähigkeit nicht mehr ausgebildet ist. Sondern auch eine Frage des eigenen politischen Interesses. Wir sind nicht vorbereitet auf diese Entwicklungen. Also machen diese Entwicklungen etwas mit uns, anstatt, dass wir etwas versuchen können zu steuern.
Sie haben den Sommer 2015 angesprochen. Verlieren wir uns auch manchmal in im Grunde unpolitischen politischen Handlungen? Ich denke an die Solidarität mit Geflüchteten, die sich im Sommer 2015 auch hier in München sehr zeigte. Sie hat aber auch nicht dazu geführt, dass sich Deutschland, dass sich Europa ernsthaft mit der Frage beschäftigt hat, welchen Anteil die eigene Politik an der Fluchtbewegung hat. Sind das Solidaritätsbekundungen im eigenen Interesse? Eher egozentrische Handlungen, aber eben keine politischen?
Das ist sehr ambivalent. Ich war in so genannten Hotspots, ich habe Helfer gesehen. Auf der einen Seite ist es fantastisch, was die machen. Das ist wirklich bewegend, gerade bei den jungen Leuten. Aber klar: Es tut auch gut, gut zu sein. Und diese Ambivalenz, diese Selbstzufriedenheit, die kann man eben auch beobachten. Ich weiß gar nicht, ob ich selbst anders wäre. Das ist nichts, was ich verurteilen könnte. Ich kann das nur beobachten.
Aber der entscheidende Punkt ist der: Die politischen Schlüsse werden nicht gezogen. Der einzige politische Schluss, der eigentlich aus 2015 gezogen worden ist, ist das Abkommen mit der Türkei. Also: "Haltet uns die Flüchtlinge vom Leib!" Es gibt keinerlei Entwicklung, weder in Deutschland, noch in der EU, noch in der UN, auf diese Entwicklungen nachhaltig zu reagieren. Obwohl wir doch wissen – das sagen alle Berichte –, dass die Flüchtlingszahlen zunehmen werden, allein schon durch die Klimakatastrophe. Es werden sich immer mehr Menschen in Bewegung setzen. Und da in irgendeiner Form eine angemessene Antwort zu finden, die nicht einfach ist… Aber solange man nicht einmal fragt, werden auch keine Antworten entstehen können. Wir sind nicht einmal in dem Stadium, dass wir uns diese Fragen stellen.
Das gilt auch für andere Dinge. Nehmen Sie die Klima-Katastrophe. Ich finde es fantastisch, dass die jungen Menschen auf die Straße gehen. Das ist enorm wichtig. Aber die Art und Weise, wie das hier behandelt wird – ob wir hier in Deutschland 2035 oder 36 zwei Prozent mehr oder weniger haben – ist bezogen auf das Klima vollkommen irrelevant. Die eigentlichen Entwicklungen geschehen natürlich nicht in Deutschland. Und hier müssten sich Deutschland und Europa vor allem einbringen. Deutschland allein ist sicherlich nicht stark genug. Aber wir haben auch das europäische Projekt beschädigt in den letzten Jahren. Eine europäische Außenpolitik ist praktisch nicht existent. Obwohl Europa dank seiner wirtschaftlichen Macht, aber vor allem auch dank seines Lebensmodells, seiner Demokratie weltweit immer noch sehr angesehen ist und Entwicklungen auch mitsteuern könnte. Aber: Europa nimmt sich selbst aus dem Spiel.
Was verrät diese Trägheit in außenpolitischen Fragen, dieses Sich-selbst-aus-dem-Spiel nehmen über den Zustand unserer Demokratie in Deutschland und in Europa?
Viel. Das ist ja nicht nur in Europa zu sehen. Die Entwicklungen in Amerika sind ja noch beängstigender. Die Spaltung der Gesellschaft, über die man so viel spricht, ist dort noch viel ausgeprägter. Wobei – wenn Sie Europa als Gesamtes nehmen – dann ist auch hier die Spaltung zwischen Ost und West schon extrem tief. Wir nehmen das im Alltäglichen nicht so wahr. Aber wenn Sie nicht nur Deutschland, Köln oder München nehmen, wenn sie Europa als Ganzes nehmen, sind die Lebenswelten auf dem polnischen Land und die Anschauung der Welt – wie man die Welt wahrnimmt – doch schon sehr anders als in Berlin-Mitte. Da sind die Spaltungen nicht weniger ausgeprägt.
Insgesamt glaube ich – das klingt jetzt ein bisschen defätistisch, das gebe ich zu –, dass Zivilisationen ihre Höhepunkte haben und auch langsam wieder im Verschwinden sind. Ich habe schon über 1989 gesprochen, wo in der eigenen Wahrnehmung der Gipfelpunkt der westlichen Kultur, der westlichen Politik, der westlichen Zivilisation war, mit dem Fall der Mauer, mit dem Scheitern des Kommunismus. Man hat nicht wahrgenommen, dass auch unser Lebensmodell im Westen natürlich an die Grenzen kommt. Das merken wir an allen Punkten, die ökologische Frage ist ja nur einer: Mit der Art und Weise, wie wir leben – immer weiter wachsen, immer weiter selbst entfalten, immer weiter das eigene Ich in den Mittelpunkt stellen – spielen dann offenbar kollektive Momente, auch kollektive Verantwortung keine ausreichende Rolle mehr.
Das führt dann eben dazu zu einer Schwächung des Gesellschaftsmodells. Ob das dann schon zum Scheitern führt? Das darf man sich nicht so vorstellen: der Schalter geht aus, alle wandern aus. Aber es führt zu einer schwächer werdenden Rolle in der Welt. Die Menschen schauen dann nicht mehr zu diesen Ländern. Und andere Akteure werden wichtiger, die Probleme eben effizienter lösen. Wir sehen, wie im Augenblick das chinesische Modell – das mir überhaupt nicht gefällt, das sehe ich als Gefahr – weltweit auch gerade in Afrika, zum Beispiel jetzt auch in Afghanistan, auf dem Vormarsch ist.
Noch einmal zurück zum Desinteresse. Sie kommen nicht aus der Politik oder von der Politik. Sie kommen von der Literatur. Und dann ist es natürlich eine Frage: Kann die Kultur oder kann, eben spezifisch, die Literatur gegen so ein Desinteresse etwas ausrichten? Das wäre ja so eine klassische Erwartung, die wir immer wieder an die Literatur richten, dass sie für das Schicksal der "Anderen" sensibilisiert, dass sie uns öffnet für Leben, die uns erst mal fremd sein mögen…
Ja. Auf der einen Ebene ganz direkt durch Kulturaustausch – der durch die Corona-Pandemie massiv behindert worden ist und auch ausgesetzt worden ist –, durch Goethe-Institute, Festivals, durch Lektüren. Was erfahren wir nicht alles durch Bücher über eine Welt? Ich erfahre oft durch Romane so viel mehr über ein Land, über eine Kultur, als über politische Analysen. Wenn ich auf Reportage-Reise gehe, bereite ich mich immer auch mit Literatur vor. Aber das ist jetzt vielleicht die direkte Rolle.
Es gibt ja noch eine viel wichtigere Rolle der Literatur, die nicht so direkt ist: Dass wir einen Blick überhaupt entwickeln für das Fremde, dass uns das Fremde zum Eigenen wird. Das ist eine grundsätzliche Haltung zum Leben. Dafür muss man auch gar nicht reisen. Das erfährt ein Leser, eine Leserin von selbst, dass Menschen woanders entweder ganz andere Probleme oder die eigenen Probleme haben, dass sie genauso denken wie man selbst. Und diese Vertrautheit mit der Welt außen herum, mit der man gar nicht reden muss, in die man gar nicht reisen muss – wir sind uns gar nicht bewusst, wieviel ärmer wir wären ohne Kunst, ohne Literatur.
Natürlich würde ich mir wünschen – das ist vielleicht auch wieder ein Punkt der Diagnose –, dass unsere Kultur, unsere Filme, speziell auch die Theater übrigens – ich merke da einen unglaublichen Run auf die Gegenwart, dass da Themen, Stücke, Texte, Fragestellungen immer enger auf die Gegenwart bezogen werden. Und wir schauen weder geografisch über unsere Welt hinaus, auf den Bühnen etwa oder auch teilweise in der Literatur. Und auch historisch. Werke, die vor 100, 250 Jahren entstanden sind, interessieren uns in der Kunst immer weniger. Da ist die Kultur eben auch ein Akteur, der von den gesellschaftlichen Entwicklungen genauso betroffen ist wie alles andere. Mich selbst – so muss ich sagen – langweilt das immer mehr, auf der Bühne auch noch zu sehen, was ich im Alltag sowieso sehe.
Wie sehen Sie die Rolle der Literatur mit Blick auf das europäische Projekt? Man soll Literatur natürlich auch nicht immer für politische Missionen einspannen. Aber ein anderes Manko, das Sie ja auch immer wieder ansprechen, ist: Wir haben uns so sehr an den Frieden, an Rechte und Wohlstand in Europa gewöhnt, dass wir eigentlich überhaupt nicht mehr realisieren, was gelungen ist mit diesem Projekt Europa. Gibt es aus Ihrer Sicht Schriftsteller, denen dieses Gespür noch nicht verloren gegangen ist und die uns Leser vielleicht auch daran erinnern?
Europa ist erschaffen worden durch seine Literatur. Und zwar durch seine vielfältige Literatur, ganz konkret am Ende des 18., Anfang des 19.Jahrhunderts. Der Gedanke eines gemeinsamen Europa ist entstanden in der Literatur, und zwar durch wechselseitige Lektüre. Das waren ganz konkrete Autoren, die das entwickelt haben, teilweise auch Philosophen wie Kant. Europa ist keine Erfindung von BASF und von Daimler-Benz, sondern von Lessing, von Goethe, von Voltaire, von all den Großen.
Schriftsteller haben – allein schon, weil sie Leser sind – automatisch teil. Sie spüren die Verwandtschaft und auch die Unterschiede zu einer französischen Tradition, zu einer englischen. Aber sie empfinden sie nicht als etwas Bedrohliches, sondern als etwas ungemein Bereicherndes, das im Austausch ist und das nicht an geografischen Grenzen halt macht. Das, was wir Europa nennen, was damals Europa genannt wurde, würde heute sicherlich nicht mehr in Ceuta aufhören, sondern weitergehen. Dieses Interesse an der Welt – ein Wort wie das Kosmopolitische, von Lessing erfunden und in die deutsche Sprache eingeführt.
Insofern: Ich glaube, Schriftsteller sind zu einem guten Teil immer noch vollkommen überzeugte Europäer, weil es an ihre eigene Existenz geht. Ob sie noch diese Emphase vertreten, wie das etwa eine Generation über uns war? Das nehme ich im Augenblick heute auch nicht so wahr. Aber eigentlich leben Schriftsteller davon, dass das eigene Denken über nationale Grenzen hinweg geht. Da ist Europa sozusagen Chiffre für ein Weltbürgertum. Auch für ein literarisches Weltbürgertum.
Wir sprechen in einer Woche, in der wir im Bayerischen Rundfunk einen Kulturschwerpunkt haben und uns auch dem Verhältnis von Kultur und Demokratie annähern wollen. Oft münden Diskussionen über Kultur und Demokratie oder Kultur und Politik schnell in einem allgemeinen Loblied auf die Literatur. Wer Ihre Texte liest und auf diese Frage hindurchschaut, der stößt im Gegenteil auf sehr Konkretes. Zum Beispiel darauf, dass die Literatur die Qualität hat, uns das Barbarische in uns selbst entdecken zu lassen. Was genau meinen Sie damit?
Das hängt davon ab, wie man das Wort barbarisch fasst. Eigentlich heißt es nur fremdsprachig und ist ein Begriff für das Fremde. Das Pejorativ ist dann im Lauf der Zeit entstanden. Die Araber nannten die Berber, die nordafrikanische Ur-Bevölkerung, Barbaren, einfach Berber, weil sie nicht arabisch sprachen. Beides ist wichtig: Einerseits zu sehen, Barbar, das ist einfach nur fremd, das ist nicht irgendwie besser oder schlechter. Er spricht einfach nur unsere Sprache nicht. Wir sind aus deren Perspektive auch Barbaren. Und zugleich zu sehen, dass wir das Fremde immer herabwürdigen, obwohl wir selbst – nehmen Sie nur etwas ganze Anthropologisches, unsere eigene Welterfahrung – wir werden geboren mit einer extremen, dramatischen Fremdheitserfahrung. Und langsam – die meisten von uns haben das Glück, dass sie einen Vater und eine Mutter haben, die sich sorgen – gewinnen wir Vertrauen.
Aber die Urerfahrung des Menschen mit seiner Geburt ist Fremdheit. Das ist etwas, was ein Leben lang in uns bleibt. Auch werden wir keineswegs so zivilisiert geboren wie wir hoffentlich dann hin und wieder werden. Die Urgewalt in uns selbst, die Aggression, ist natürlich weiter in uns. Und die Literatur wie überhaupt die Kunst ist ein Medium, um uns mit diesen Kräften auseinanderzusetzen, auf diese Kräfte zu schauen, sie auch auf die Bühne, auf‘s Blatt zu bringen. Ich finde es auch langweilig, wenn die Menschen auf Bühnen oder in Romanen immer alle so wunderbar gut sind. Nein, die sind doch gerade dafür da, dass wir genau diese Dinge, die Mörder, die Vergewaltiger, das Böse in uns selbst, den Hass, die Eifersucht da verhandeln – damit sie eben nicht ins politische Handeln münden. Das ist ja der gesellschaftliche Grund, warum es überhaupt Theater, Literatur, all das gibt. Schiller hat das wunderbar formuliert, dass wir in diesem Spiel die Möglichkeit haben, unser ganzes Menschsein – und zwar auch mit den Abgründen – zu leben, damit wir im Alltag halbwegs zivilisierte Menschen sind.
Wenn wir in der Literatur das Barbarische in uns selbst entdecken – wie verändert das dann noch mal unseren Blick in der Realität für die, die wir Fremde nennen?
Zunächst würde ich, vielleicht auch zeitkritisch, einmal anmerken, dass die jetzige Entwicklung den Sinn von Kulturen überhaupt in Frage stellt. Das ist gerade der Sinn, dass wir ein Macbeth, einen Richard III. haben, weil sie nicht sind, wie wir sie haben wollen. Sondern weil sie etwas uns spiegeln, was wir vielleicht in uns haben – und was da vielleicht formuliert ist.
Wenn wir das verlieren, wenn wir dieses Kernelement von Kultur von Kunst nicht mehr haben und meinen, im Buch, auf der Bühne müsste die Welt so sein, wie wir sie uns wünschen, dann schaffen wir eigentlich Kunst und Kultur ab. Dann wird das nur zur Selbstbestätigung. Es gibt immer wieder fantastische Ausnahmen oder auch große Abende. Aber die Tendenz dazu, uns die Welt draußen und in uns selbst vom Leib zu halten oder sie uns so zu modellieren, wie sie sein soll, die nehme ich schon immer stärker war.
Wir haben zu Beginn über das Desinteresse an außenpolitischen Fragen gesprochen. Auch über Handlungen, die politisch aussehen aber womöglich im Grunde keine politische Handlung auslösen in einem zweiten Schritt. Gerade wenn man das im Hinterkopf hat, fand ich es interessant, dass Sie – in einem ganz anderen Kontext gesagt haben – Literatur könne eben auch die Stärke haben, eine Art Nische des Unpolitischen, des Privaten und der Kunst zu bieten. Es ging damals um den iranischen Schriftstellerverband. In welchem Kontext kann denn gerade das Einstehen für das Unpolitische eine Qualität von Literatur oder von Literaten sein?
In allen ideologisierten Gesellschaften – wo jede Lebenshandlung ideologisiert ist, wo selbst in Quizsendungen die ideologisch richtigen Antworten verlangt werden – ist gerade das Beharren der Literatur, der Kunst auf Privatem, auf nicht Verwertbarem, enorm wichtig, auch politisch, um dieses Moment zu bewahren.
Wir sind jetzt auch in der Zeit – ich will das gar nicht vergleichen, aber ich merke es selbst auch an Anfragen, an den Leserbriefen, die mich erreichen, an den Diskussionen –, in der es gerade bei jüngeren Lesern einen Hang gibt, die Dinge sehr politisch zu betrachten. Das ist einerseits sehr zu begrüßen. Andererseits aber die Art und Weise, wie wir sprechen: Da ist Sprache zu einem Instrument politischer Veränderung geworden, indem man so spricht und nicht anders spricht. Ich glaube, darauf zu beharren, dass Sprache kein Instrument ist zur Veränderung der Wirklichkeit, sondern ein Medium, in dem sich Wirklichkeit, – auch eine sich verändernde Wirklichkeit ausdrückt. Dieses Nicht-Politische wird im Augenblick auch in Deutschland, in Europa auch auf eine paradoxe Weise wieder wichtiger werden, als wir es vielleicht den letzten Jahren hatten. Wo man auch zurecht diesen politischen Auftrag angemahnt hat.
Kultur und Demokratie? Wir haben Autorinnen, Künstler, Intellektuelle nach ihrer Vorstellung von der Zukunft gefragt. Was muss sich ändern? Was kann und muss jeder Einzelne tun? Eine Essay-Reihe über die Zukunft der Demokratie.
Das Interview mit Navid Kermani läuft im Kulturjournal auf Bayern 2 , das Sie hier nachhören und abonnieren können.