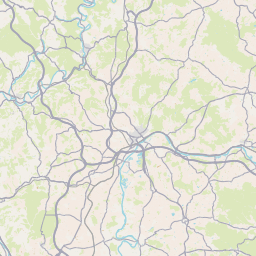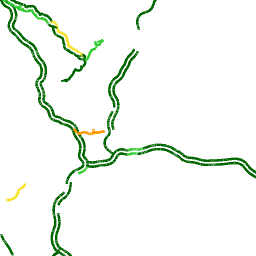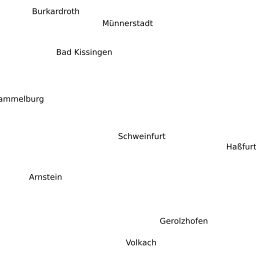Schutz und Risiko zugleich Rolle der Familie bei psychischen Krankheiten
Manche Krankheiten, also etwa affektive Störungen wie z.B. Depressionen, entwickelt man eher, wenn man alleine ist. Denn ein Ansprechpartner oder familiäre Unterstützung könnten hier als Schutzfaktor wirken. Auch die Erfahrung einer sicheren Bindung, die man in der Regel in der Familie macht, kann vor psychischen Krisen schützen.

Menschen, die sichere Bindungen in der Kindheit erfahren haben, haben das Gefühl, geliebt zu sein, dazuzugehören. Sie haben nicht das Gefühl, sich ständig beweisen zu müssen. Sie haben Liebe, Geborgenheit und Urvertrauen dadurch entwickelt, dass jemand da war, der sie getröstet hat, wenn sie hingefallen sind und sich das Knie aufgeschlagen haben. Diese Erfahrung der Zuwendung hilft, mit seelischen Krisen später besser umgehen zu können.
Familie als Krankmacher
Umgekehrt kann es in der Familie aber auch krankmachende Faktoren geben: etwa, wenn Kindern die Selbstständigkeit genommen wird, wenn sie nie die Möglichkeit haben, sich auszuprobieren und auch mal Fehler machen können. Auch Hyperindividualismus durch zu viel gut gemeinte Förderung kann schädlich sein – weil dann ein großer Erwartungs- und Erfolgsdruck auf den Kindern lastet. So können manche psychischen Krankheiten wie etwa Panikattacken eher in Zusammenhang mit der Familie stehen: beispielsweise, wenn ein heranwachsendes Kind Schwierigkeiten hat, sich vom Elternhaus zu lösen und dann vielleicht Panikattacken bekommt, wenn es allein im Auto unterwegs ist. Die Panikattacke ist dann nur ein Symptom für ein tieferliegendes Problem.
Beispiel Essstörungen
Ein anderes Beispiel, das immer wieder in Zusammenhang mit der Familie diskutiert wird, sind Essstörungen, also z. B. Magersucht und Bulimie. Oftmals empfehlen sich hier neben anderen Zugängen auch Elemente einer systemischen Familientherapie. Das problematische Essverhalten ist nämlich oft nur ein Hinweis, ein Symptom, dass in der Familie etwas im Ungleichgewicht ist. Allerdings darf dabei nicht übersehen werden: Magersucht und Bulimie betreffen in neun von zehn Fällen junge Mädchen und junge Frauen, die größtenteils – weil sie noch nicht volljährig sind – noch bei den Eltern leben. Daraus den Schluss zu ziehen, nur die Familiensituation sei ursächlich verantwortlich für die Erkrankung, wäre fatal. Es liegt eben auch viel an den speziellen Themen dieser Altersgruppe und dem Druck aus Werbung etc.
Liegt's am Alter oder an der Familie?
Insgesamt muss dieser Aspekt immer mitbedacht werden, wenn es um betroffene Kinder und Jugendliche geht: Sind Schlafstörungen oder Ängste darauf zurückzuführen, dass in der Familie etwas nicht stimmt, oder treten sie auf, weil das Kind ein bestimmtes Alter hat – in dem es sich einfach mehr vor der Dunkelheit ängstigt. Bei der Diagnostik psychischer Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen ist es deshalb sehr wichtig, sensibel vorzugehen und sich diese Fragen zu stellen: Ist die Erkrankung familienbedingt? Ist sie altersbedingt? Und wie könnte die Familie als Schutzfaktor fungieren? Persönlichkeitsstörungen werden deshalb im Kindes- und Jugendalter in der Regel noch nicht diagnostiziert. Andere Diagnosen wie etwa Trichotillomanie, also krankhaftes Haareausreißen, oder eine Fütterstörung treten vorwiegend oder nur im Kindes- und Jugendalter auf und haben also nicht zwangsläufig mit der Familie zu tun. Das Klassifikationssystem ICD listet sie sogar in einer eigenen Kategorie.
Fazit:
Insgesamt lässt sich also festhalten: Es ist ziemlich normal, dass psychische Krankheiten in Familien auftreten. Die Frage ist eher: Wie geht die Familie damit um?