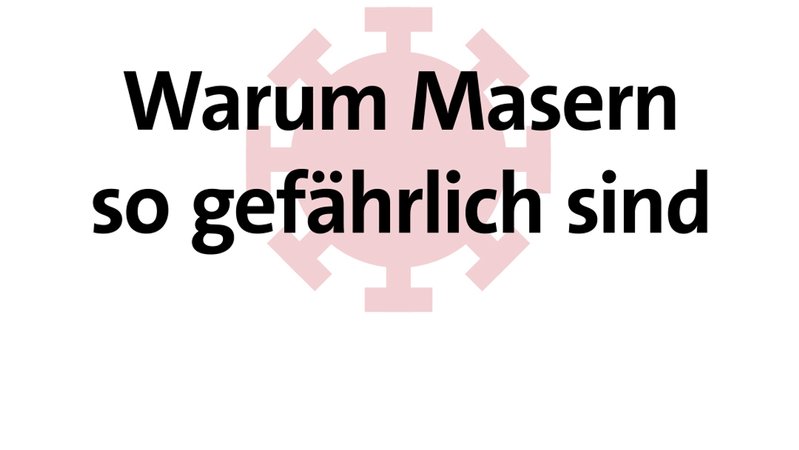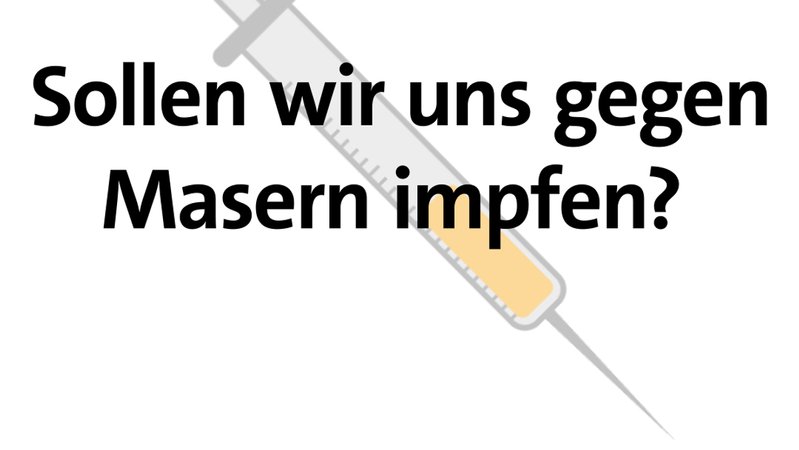Durch die Masernimpfung konnte die Zahl der Erkrankungen in der Vergangenheit global stark reduziert werden - von 1980 bis 2013 um über 95 Prozent. Bedingt durch die Impfmüdigkeit in den Industrieländern, die globale Migrationsbewegung und die Pandemie gab es zuletzt weltweit allerdings wieder viel mehr Masernfälle. Schon im Januar 2019 hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Masern wegen der weltweit ansteigenden Infektionszahlen zur Bedrohung der globalen Gesundheit erklärt und Erwachsenen empfohlen, ihren Impfschutz zu prüfen.
Masernfälle in Europa um das 30-Fache gestiegen
Das Regionalbüro der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Europa ist besorgt: Zwischen Januar und Oktober 2023 seien in der Region 30 Mal so viele Masernfälle registriert worden wie im ganzen Jahr davor. In diesem Zeitraum seien aus 40 der 54 Mitgliedsstaaten der Region, die sich bis Zentralasien erstreckt, über 30.000 Fälle gemeldet worden - gegenüber 941 Fällen im gesamten Jahr 2022, teilte das WHO-Büro mit.
Am stärksten betroffen waren Kasachstan und Russland mit jeweils mehr als 10.000 Fällen. In Westeuropa war Großbritannien mit insgesamt 183 gemeldeten Fällen am meisten betroffen. Besonders besorgniserregend sei es, dass es in dem Zeitraum 21.000 Einweisungen in Krankenhäuser und fünf Todesfälle gegeben habe, erklärte WHO-Regionaldirektor Hans Kluge.
Impfanstrengungen verstärken
Umso dringlicher sei es, die Impfanstrengungen zu verstärken, um eine Wiederausbreitung der Masern zu verhindern, erklärte das Regionalbüro. Alle Länder müssten darauf vorbereitet sein, "Masernausbrüche rasch zu erkennen und rechtzeitig darauf zu reagieren". Sonst wären die Fortschritte bei der Ausrottung der Masern in Europa gefährdet.
Rund 83 Prozent der Menschen haben weltweit im Leben eine erste Impfdosis erhalten, 74 Prozent eine zweite. Es müssten aber nach WHO-Angaben 95 Prozent der Menschen geimpft sein, um größere Ausbrüche zu verhindern. Die Impfquoten gegen Masern sind laut WHO während der Corona-Pandemie gesunken. Anhaltende Immunitätslücken und verpasste Impfungen hätten viele Menschen, darunter eine größere Zahl von Kindern, für diese potenziell tödliche Krankheit anfällig gemacht. Allein in der WHO-Region Europa wurden rund 1,8 Millionen Säuglinge zwischen 2020 und 2022 nicht gegen Masern geimpft.
Wie häufig treten Masern in Deutschland auf?
Seit Einführung der Meldepflicht der Masern im Jahr 2001 ging die Anzahl der Masernfälle in Deutschland aufgrund steigender Impfquoten drastisch zurück. Seit 2020 liegt die Inzidenz der Masern in Deutschland unter der von der WHO geforderten Inzidenz von 1 Fall pro 1 Million Einwohner. Zudem herrscht in Deutschland seit März 2020 eine Masernimpfpflicht. Eltern müssen jetzt vor dem Eintritt ihrer Kinder in die Kita oder Schule nachweisen, dass diese gegen Masern geimpft sind oder bereits an Masern erkrankt waren.
Das spiegelt sich in den Erkrankungszahlen wider, gleichwohl sie auch in Deutschland wieder leicht steigen. 2023 wurden laut Abfrage beim Robert Koch-Institut (RKI) 53 Masernfällen an das RKI übermittelt - mit besonderem Peak in Berlin (14) und Sachsen-Anhalt (18). Im Jahr 2022 waren es insgesamt 14 Fälle, 2021 neun Fälle. Für 2024 wurden bereits 10 Fälle gemeldet.
Was sind Masern und wie werden Masern übertragen?
Masern sind eine hochansteckende Infektionskrankheit, die durch Viren ausgelöst wird. Lange Zeit galten Masern als typische Kinderkrankheit, immer häufiger infizieren sich jedoch auch Jugendliche und Erwachsene mit dem gefährlichen RNA-Virus. Bei ihnen ist der Verlauf der Krankheit meist schwerer als bei Kindern.
Das Virus wird über Tröpfchen in der Atemluft übertragen. Sprechen, Husten oder Niesen eines Infizierten kann für eine Übertragung des Virus schon genügen. Denn um sich mit dem Virus anzustecken, reicht es aus, die Keime einzuatmen. Über die oberen Atemwege oder die Augenbindehaut kann der Erreger in den Blutkreislauf gelangen. Auch der direkte Kontakt mit dem infektiösen Sekret aus Rachen oder Nase ist ansteckend. Das Trinken aus demselben Glas eines Masern-Infizierten oder die Benutzung desselben Bestecks kann daher ebenfalls für eine Ansteckung ausreichen.
Bis zu zwei Stunden kann das Masern-Virus in der Luft überleben. Laut RKI und dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte führt der Kontakt mit Masernviren bei nahezu 100 Prozent der Fälle zu einer Infektion, bei über 95 Prozent kommt es zu einem Krankheitsausbruch mit Symptomen.
Weil das Virus so ansteckend ist, ist eine hohe Impfquote bei Masern besonders wichtig. Die Impfung schützt nämlich auch diejenigen, die nicht geimpft werden können. Babys haben nach der Geburt noch keine Abwehrkräfte gegen das Masernvirus. Werden sie von ungeimpften Kindern oder Erwachsenen angesteckt, drohen ein sehr schwerer Krankheitsverlauf und Komplikationen bis hin zum Tod. Auch Ungeborene sind gefährdet, denn bei ungeimpften Schwangeren können Masernviren die Plazenta überwinden und das werdende Kind infizieren.
Im Video: Warum Masern gefährlich sind
Warum Masern so gefährlich sind
Was sind die Symptome von Masern?
Zu den typischen anfänglichen Anzeichen einer Infektion gehören grippeähnliche Symptome wie Fieber, Schnupfen, Halsschmerzen und trockener Husten. Hinzu können Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Kopf- und Bauchschmerzen sowie Lichtempfindlichkeit kommen, verbunden mit einer Bindehautentzündung, die sich vor allem durch tränende Augen bemerkbar macht.
Erst in einer zweiten Phase der Erkrankung - etwa zwei bis vier Tage nach Auftreten der ersten Symptome - kommt es zu dem für Masern typischen Hautausschlag. Das Gefährliche daran: Schon mehrere Tage bevor der Hautausschlag auftritt, ist der Infizierte für andere Personen hochansteckend - aber weiß bis dahin in der Regel noch gar nichts von seiner Erkrankung.
Welche Komplikationen kann eine Maserninfektion haben?
In den meisten Fällen heilen Masern problemlos aus. Bei zehn bis 20 Prozent der Erkrankten kommt es allerdings zu Komplikationen. Gefürchtet ist dabei vor allem die sogenannte subakute sklerosierende Panenzephalitis (SSPE), eine Gehirnentzündung. Sie tritt zwar nur sehr selten als Folge einer Maserninfektion auf – etwa bei einer von 1.000 erkrankten Personen – endet aber immer tödlich. Das Tückische an dieser Folgeerkrankung: Sie tritt erst sechs bis acht Jahre nach der Infektion mit dem Masernvirus auf.
Auch andere Komplikationen sind nach einer Maserninfektion möglich. So kann eine schwere Form einer Lungenentzündung auftreten, die sogenannte Riesenzellpneumonie, oder die sogenannte Masern-Einschlusskörper-Enzephalitis, eine im Vergleich zur SSPE etwas weniger gefährliche Entzündung des Gehirns. Beide Komplikationen führen in etwa 30 Prozent der Fälle zum Tod.
Forscher aus England, Holland und den USA konnten in Studien, die im November 2019 in den Fachblättern Science und Science Immunology veröffentlicht wurden, zudem belegen, dass eine Maserninfektion - selbst wenn sie scheinbar schadlos überstanden wurde - unser Immunsystem über lange Zeit schwächt.
Masern sind beileibe keine harmlose Kinderkrankheit. Die Einführung der Impfpflicht insbesondere für Kinder soll die Infektionsgefahr verringern.
Wie werden Masern diagnostiziert und wie läuft die Therapie?
Wegen der starken Ähnlichkeit der Symptome zu Röteln, Ringelröteln und Scharlach muss zur Absicherung der Diagnose von Masern eine Blutuntersuchung gemacht werden, bei der die entsprechenden Antikörper als Zeichen einer Maserninfektion festgestellt werden können. Die Gefahr: Wegen der grippeähnlichen Symptome im Anfangsstadium der Erkrankung werden Masern oft nicht erkannt und falsch behandelt.
Bei einer Maserninfektion vor Ausbruch der Krankheit schützt eine sogenannte postexpositionelle Impfung vor einer Erkrankung. Bei abwehrgeschwächten Personen ist innerhalb von zwei bis drei Tagen nach Kontakt mit dem Virus die Verabreichung von verschiedenen Eiweißen, sogenanntem humanem Immunglobulin, als Prophylaxe möglich.
Sind die Masern ausgebrochen, helfen Ruhe und absolute Schonung sowie eine immunstärkende Ernährung und ausreichend Flüssigkeitszufuhr. Bei entsprechenden Symptomen sollte man aber auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
Masernimpfung: Was empfiehlt die STIKO?
Die Ständige Impfkommission (STIKO) am Robert Koch-Institut in Berlin empfiehlt eine erste Masernimpfung zwischen dem vollendeten 11. bis zum 14. Lebensmonat. Eine zweite Masernimpfung, um einen zuverlässigen Schutz zu gewährleisten, sollte nach Empfehlung der STIKO im Alter von 15 bis 23 Monaten erfolgen. Sie kann bereits vier bis sechs Wochen nach der ersten Impfung durchgeführt werden. Meist wird bei beiden Impfungen ein Kombinationsimpfstoff verwendet: Es gibt die 3-fach-Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR-Impfung) oder die 4-fach Impfung, die zusätzlich gegen Windpocken (MMRV) schützt.
Wer nach 1970 geboren ist, nur einmal oder gar nicht geimpft ist, sollte nach Empfehlung der STIKO eine Masernimpfung nachholen. Das gilt auch generell für Personen, die nicht wissen, ob sie jemals geimpft wurden.
Im Audio: Masern-Infektionen können schwere Komplikationen hervorrufen
Masern sind nicht nur unangenehm. Bei 10 bis 20 Prozent der Erkrankten können Komplikationen auftreten.
Welche Impfstoffe gibt es und wie funktioniert die Masern-Impfung?
Seit 2018 gibt es in der EU keinen Einzelimpfstoff gegen Masern. Die Kombinationsimpfstoffe, wie sie derzeit in Deutschland verimpft werden, haben laut RKI deutliche Vorteile gegenüber einem Einzelimpfstoff.
Der Masern-Mumps-Röteln-Impfstoff (MMR), der für die Masern-Impfung verwendet wird, "ist ein Lebendimpfstoff, der abgeschwächte, vermehrungsfähige Viren enthält. Die abgeschwächten Masern- und Mumps-Impfviren können nicht auf Kontaktpersonen übertragen werden", schreibt das RKI in seinem Faktenblatt über die Masern-Impfung.
Lebendimpfstoffe enthalten zwar Krankheitserreger. Sie sind aber so abgeschwächt worden, dass sie die Krankheit selbst nicht auslösen. Trotzdem vermehren sie sich im Körper und trainieren die Immunabwehr, sodass der Geimpfte nach einer Impfung vor einer Infektion geschützt ist.
Welche Impfreaktionen und Nebenwirkungen können nach der Masern-Impfung auftreten?
Vor allem nach der ersten Impfung können Reaktionen wie Fieber und Kopfschmerzen auftreten. Manche Geimpfte bekommen auch Hautausschlag, die sogenannten Impfmasern. "Studien weltweit zeigen, dass schwere unerwünschte Nebenwirkungen bei den MMR(V)-Impfstoffen nur sehr selten auftreten", heißt es auf der Webseite des RKI. Die Ständige Impfkommission empfehle daher die Verwendung von Kombinationsimpfstoffen "ausdrücklich".
Nach einer zweifachen Impfung gegen Masern - wie von der STIKO empfohlen - "wird grundsätzlich eine lebenslange Immunität angenommen", schreibt das RKI auf seiner Internetseite.
Im Video: Sollen wir uns gegen Masern impfen?
Sollen wir uns gegen Masern impfen?
Mit Material der Nachrichtenagentur dpa
Dieser Artikel ist erstmals am 22. August 2022 auf BR24 erschienen. Das Thema ist weiterhin aktuell. Daher haben wir diesen Artikel aktualisiert und erneut publiziert.
Das ist die Europäische Perspektive bei BR24.
"Hier ist Bayern": Der BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!