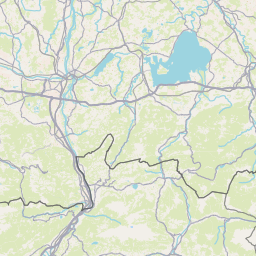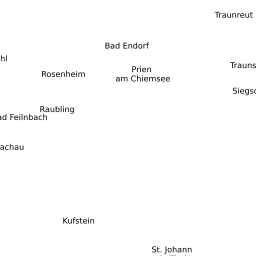#factfox Europäische Gerüchteküche
Die EU - Watschenmann für jedermann. Über die Europäische Union kursieren viele angebliche Wahrheiten: Bürokratiemonster, Vorschriftenschleuder, Politikerseniorenresidenz. Was ist dran an den Gerüchten?

Richtig ist: Die EU verfügt über einen eindrucksvollen Verwaltungsapparat. Allerdings werden in Brüssel (und den beiden anderen Europastädten Luxemburg und Straßburg) auch wichtige Entscheidungen getroffen. Unter anderem geht es um viel Geld, das den Menschen in den Mitgliedsstaaten zugutekommt, zum Beispiel in Form von Regionalhilfen oder Direktzahlungen für Landwirte. Und dessen Verteilung ist ohne ein Mindestmaß an bürokratischem Aufwand (Anträge, Formulare, Kontrollen) schwer möglich.
Im Verhältnis zu den mehr als 500 Millionen EU-Bürgern ist die Zahl der „EU-Beamten“ sogar erstaunlich klein: insgesamt arbeiten nach offiziellen Angaben etwa 33.000 Menschen für die Kommission, das entspricht ziemlich genau dem Personalbestand der bayerischen Landeshauptstadt. In allen europäischen Institutionen zusammen (also einschließlich Rat, EU-Parlament und EU-Gerichtshof) sind rund 55.000 Angestellte beschäftigt. Damit kommt ungefähr ein Verwaltungsbeamter auf 10.000 Einwohner. In München beträgt das Verhältnis 1:40.
Auch die Kosten erscheinen in Relation zum Gesamthaushalt der EU vertretbar: Rund acht Milliarden Euro im Jahr zahlen Bürgerinnen und Bürger für die Brüsseler Bürokratie. Die (noch) 28 Mitgliedsstaaten geben für ihre Verwaltungen zusammen fast 300 Mal so viel aus. Pro Kopf beläuft sich die Summe auf 16 Euro jährlich, wobei ein Teil des Geldes z.B. dafür aufgewendet wird, alle wichtigen Texte und Dokumente in die 24 Amts- und Arbeitssprachen der Union zu übersetzen. 94 Prozent der EU-Mittel (2017: circa 135 Mrd. Euro) fließen in die Mitgliedsstaaten. Das jährliche EU-Budget entspricht ungefähr einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts der EU-Mitgliedsstaaten.
Richtig ist: In absoluten Zahlen ist Deutschland der mit Abstand größte Nettozahler der Europäischen Union. Das heißt, laut offizieller Statistik der EU-Kommission überweist die Bundesrepublik regelmäßig deutlich mehr Geld nach Brüssel, als sie an Leistungen von dort zurückbekommt. In den vergangenen Jahren war das meist ein Betrag zwischen 14 und 16 Milliarden Euro. Insgesamt zahlen zwölf der 28 EU-Staaten mehr Geld ein, als sie empfangen. Zweitgrößter EU-Finanzierer waren bisher die Briten, deren Netto-Beitrag von circa 10 Milliarden Euro durch den Brexit wegfällt. Wahrscheinlich wird er auf die verbleibenden 27 Mitglieder umgelegt, wodurch der deutsche Beitrag zum EU-Haushalt nochmal um rund 2 bis 3 Milliarden Euro jährlich steigen dürfte.
Umgerechnet auf die Bevölkerung zahlen andere EU-Mitgliedsländer allerdings mehr ein als die Deutschen. So kommen beispielsweise die Niederländer auf einen Pro-Kopf-Anteil von netto rund 219 Euro, die Schweden auf 225. Jeder Bundesbürger zahlt statistisch gesehen 176 Euro.
Wer nur auf den EU-Haushalt schaut, übersieht jedoch das Wesentliche. Denn Deutschland ist auch das Mitgliedsland, das am meisten vom europäischen Binnenmarkt und vom Euro profitiert. So stiegen die deutschen Ausfuhren seit den 90er Jahren, v.a. nach der EU-Osterweiterung, rasant. Zwischen 2003 und 2007, dem Jahr vor der Finanzkrise, sogar um jährlich über 9 Prozent. Fast jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland hängt direkt oder indirekt vom Export ab.
Richtig ist: Die Regulierung des europäischen Binnenmarktes, mit seinen über 500 Millionen Konsumenten und rund 20 Billionen Euro Wirtschaftsleistung, ist eine der wichtigsten und zugleich kompliziertesten Aufgaben der EU-Behörden. Diese Aufgabe wurde ihnen von den Mitgliedsstaaten im Rahmen der EU-Verträge übertragen. Ziel ist es, möglichst für alle „Marktteilnehmer“ – also Verbraucher, Unternehmen und Mitgliedsländer – möglichst einheitliche Bedingungen zu schaffen, im Interesse eines fairen Wettbewerbs und sicherer Produkte.
Um dieses Ziel zu erreichen, sind Richtlinien und Verordnungen nötig, die zum Teil stark ins Alltagsleben von Bürgern und Betrieben eingreifen. Ohne Zweifel ist die EU im Laufe der Zeit dabei auch übers Ziel hinausgeschossen. So haben die gerade beginnenden Brexit-Verhandlungen gezeigt, dass der gemeinsame Rechtsbestand der EU (der sogenannte Acquis Communautaire) derzeit rund 21.000 Legislativakte, also Gesetze, umfasst. Insgesamt sind das 100.000 Einzelbestimmungen. Ob all diese Regelungen wirklich sinnvoll sind, wäre zu prüfen.
Andererseits hat man das Problem der Überregulierung längst erkannt und darauf reagiert. Unter dem Motto „groß in großen Dingen und klein in kleinen“ hat Kommissionschef Juncker den EU-Bürgern konsequenten Bürokratieabbau und die Rückbesinnung auf das Subsidiaritätsprinzip versprochen. Sein Team hat der Luxemburger angewiesen, sämtliche Maßnahmen einem Bürokratie-Check zu unterziehen und auf erkennbar Überflüssiges zu verzichten. Juncker-Stellvertreter Timmermans ist speziell für den Bereich „Better Regulation“ zuständig. Im Rahmen des sogenannten REFIT-Programms (= Regulatory Fitness and Performance) werden außerdem bestehende EU-Gesetze vereinfacht oder abgeschafft. Seit Amtsantritt (2014) hat die Juncker-Kommission rund 100 Gesetzesvorschläge zurückgezogen und 80 Prozent weniger Initiativen eingebracht als die Vorgänger-Kommission unter Barroso.
Als ehrenamtlicher „Bürokratiejäger“ war übrigens acht Jahre lang der frühere bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Edmund Stoiber in Brüssel tätig. Er ist stolz darauf, die rund 23 Millionen Betriebe in der EU in dieser Zeit um ein Viertel der bürokratischen Bürden entlastet und über 30 Milliarden Euro eingespart zu haben.
„Brüssel“ steht stellvertretend für absurde und realitätsferne Vorschriften, die keiner braucht und die den Menschen nur das Leben schwer machen. Jeder schimpft gern auf die eigenmächtigen „Euro-kraten“ in Brüssel und ihren vermeintlichen Regulierungs- und Vereinheitlichungswahn. Als Beweis fallen die unvermeidlichen Begriffe Glühbirnenverbot und Gurkenkrümmungsnorm; in jüngster Zeit ergänzt um die berühmte Ölkännchen-Verordnung.
Das alles sind zugegebenermaßen unterhaltsame Beispiele, um die EU und ihre Vertreter als bürokratisch, weltfremd und überflüssig hinzu-stellen. Insofern haben sie beträchtlichen Anteil am schlechten Image der EU und werden von ihren Gegnern fleißig strapaziert. Das Problem: es sind falsche Beispiele und sie gehören eigentlich ins Reich der Mythen, Klischees und Vorurteile. Leider halten sie sich seit Jahren hartnäckig – in der Boulevardpresse, an den Stammtischen und neuerdings auch in den sozialen Netzwerken. Zugleich lässt sich an ihnen gut zeigen, wie „Brüssel“ zum Sündenbock für Regelungen gemacht wird, die im Interesse einzelner Lobbygruppen oder nationaler Regierungen sind.
Beispiel Glühbirne: ihr Verbot ist nicht, wie gern behauptet wird, auf Brüsseler Mist gewachsen, sondern auf dem Schreibtisch des damaligen Bundesumweltministers Gabriel. Der ließ sich 2007 vom Vorbild Australien inspirieren und hielt es für eine exzellente Idee, die „gute alte Glühbirne“ durch die viel effizientere, allerdings auch teurere und ökologisch nicht unbedenkliche Energiesparlampe zu ersetzen. Auf diese Weise konnte man zugleich einen bedeutenden Schritt zu mehr Klimaschutz tun. Die Maßnahme wurde damals von allen anderen EU-Staats- und Regierungschefs gutgeheißen und stieß auch im EU-Parlament nicht auf Widerstand. Die Kommission, als ausführendes Organ, goss das Glühbirnenverbot lediglich in Gesetzesform.
Ironie der Geschichte: im Rückblick erweist sich die Umstellung als keineswegs absurd, und die damalige Aufregung hat sich weitgehend gelegt. Auch weil moderne LED-Leuchten ebenfalls Strom sparen, aber kein giftiges Quecksilber enthalten und kein fahles, bläuliches Licht verbreiten. Auch die USA, Kanada und Neuseeland sind mittlerweile auf Energiesparlampen umgestiegen.
Ähnlich wie mit der Glühbirne verhält es sich im Übrigen mit der Gurke, dem wohl bekanntesten Beispiel für die als unnötig oder lächerlich empfundene Brüsseler Regelungswut. Auch hier kam der Anstoß aus den Mitgliedsstaaten. Wahr ist: Agrar-Erzeugnisse wurden schon immer in verschiedene Qualitäts- und Handelsklassen eingeteilt, nicht erst durch die EU. In Deutschland etwa gab es schon in den frühen 70er Jahren eine entsprechende Verordnung für Obst und Gemüse, die nicht auf einer Brüsseler Vorlage basierte.
Solche Normierungen haben praktische Gründe, bei denen vor allem die Interessen der Hersteller eine Rolle spielen. Im Fall der Salatgurken war Erzeugern und Händlern daran gelegen, dass jeweils eine bestimmt Anzahl in einen genormten Karton passt. Und das lässt sich eben am besten gewährleisten, indem man den Krümmungsgrad festlegt. Als es darum ging, die Gurkennorm wieder abzuschaffen, kam der Widerstand nicht aus Brüssel, sondern aus Deutschland, Österreich, Frankreich und einer Reihe anderer EU-Länder. Trotzdem fiel sie im Juli 2009 dem Rotstift zum Opfer.
Mit Recht gestoppt wurde seinerzeit der Vorschlag, Gastwirten das Aufstellen von Einweg-Ölkännchen mit genormtem Etikett vorzuschreiben. Auch diese Idee hatte freilich einen durchaus gutgemeinten Kern. Ziel war es, die Qualität des angebotenen Öls zu steigern, und Restaurantbesucher vor gepanschtem und womöglich gesundheitsschädlichem Öl zu schützen, was auch im Interesse der Hersteller gelegen hätte. Weil sich die Kommission vorher aber nicht ausreichend mit Verbraucherschützern und Mitgliedsstaaten abgestimmt hatte, verschwand das Projekt in der Versenkung. Auch die Bundesregierung begrüßte den Rückzieher: Das Ölkännchen-Verbot hätte unnötige Bürokratie und jede Menge zusätzlichen Verpackungsmüll verursacht, und es wäre mehr Öl aus angebrochenen Flaschen weggeschüttet worden, lauteten die Argumente.
Richtig ist: Ein besonders hartnäckiges Vorurteil über Brüssel und seinen Institutionen besagt, dort würden – neben EU-Bürokraten – vor allem Nichtskönner und abgehalfterte Polit-Geronten ihr Unwesen treiben. Eine Versetzung in die EU-Hauptstadt sei entweder eine Belohnung für treue Dienste an Partei und Land oder eine Quarantäne-Maßnahme, damit der Betreffende daheim keinen Schaden mehr anrichtet. Der Volksmund hat dafür sogar einen Spottvers gedichtet: "Hast du einen Opa, schick‘ ihn nach Europa!"
Wahr ist dagegen: die Zeiten, da Brüssel eine Art Seniorenheim oder „Elefantenfriedhof“ für ehemalige Minister oder Ministerpräsidenten war, sind lange vorbei. Die Mitgliedsstaaten nehmen die europäische Ebene ernst. In die Kommission oder ins EU-Parlament schicken sie längst nicht mehr nur Altpolitiker mit klangvollen Namen, sondern kompetente Führungskräfte. Speziell das deutsche Personal kann sich hier durchaus sehen lassen: Martin Selmayr etwa, rechte Hand von Kommissionspräsident Juncker; oder Klaus Regling, Chef des europäischen Stabilitätsfonds ESM. Und der neue SPD-Vorsitzende und Kanzlerkandidat Martin Schulz beweist gerade, dass Europa sogar ein Karriere-Sprungbrett zurück auf die nationale Bühne sein kann.