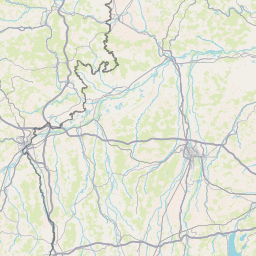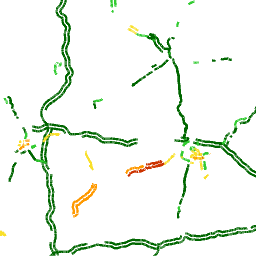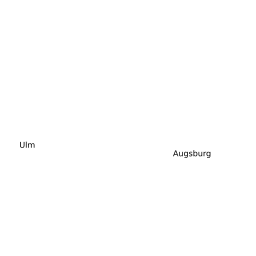Stadt-Geschichten Dialekt auf dem Rückzug?
Schülerinnen und Schüler des P-Seminars Dialekt am Dossenberger-Gymnasium in Günzburg haben in Zusammenarbeit mit der Stiftung Zuhören und dem Bayerischen Rundfunk den Sprachgebrauch ihres Heimatortes erkundet und Einstellungen zum Dialektgebrauch dokumentiert. Die wissenschaftliche Beratung erfolgte durch Ralf Knöbl vom Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim. Am Ende des Projekts wurden die Aufnahmen in einem Gespräch mit Ralf Knöbl gemeinsam ausgewertet.

Sie haben jetzt unsere Aufnahmen gehört. Was fanden Sie besonders interessant?
Die Aufnahmen sind in ihrer großen Bandbreite sehr aufschlussreich. Man bekommt einen guten Eindruck von der Sprachwirklichkeit. Es fällt auf, dass von ein und derselben Person teilweise Dialekt gesprochen wird, aber eben nicht nur. Es kommt zu sogenannten Codeswitches, d. h. der Sprecher wechselt von einer dialektnahen Sprechweise zu einer standardnahen – und umgekehrt.
Woran liegt es, dass in städtischen Gebieten so deutlich weniger Dialekt gesprochen wird als in ländlichen?
Ein wesentlicher Grund für die Standardannäherung in städtischen Gebieten ist vor allem der Kontakt zwischen Sprechern, die sich nicht kennen. Da ist es sicherer, den Standard zu nehmen – also etwas, das gewissermaßen eine Norm ist –, weil man dann davon ausgehen kann, dass man von allen verstanden wird. Aber in der traditionellen, dörflichen Gemeinschaft kennt man sich.
Joseph Weizenegger vom Historischen Verein Günzburg nennt als Grund für den Rückgang des Dialekts, dass sich junge Menschen schämen, Schwäbisch zu sprechen.
Da ist was dran. Unsere eigenen Untersuchungen zeigen, dass Jugendliche oft den Dialekt beherrschen, ihn aber eben nicht verwenden. „Schämen“ passt insofern, als in Umfragen belegbar ist, dass das Schwäbische ein echtes Prestigeproblem hat, und zwar im sogenannten Autostereotyp, also in der Eigeneinschätzung, aber auch in der Einschätzung von außen, also im Heterostereotyp. Sächsisch schneidet immer ganz schlecht ab, aber dann kommt immer schnell auch das Schwäbische. Und wenn man als junger Mensch prestigeempfindlich ist – und das sind die meisten – dann verändert man seine Sprache.
Also wäre es gar nicht so schlecht, wenn das Thema Mundart und Dialekt in der Schule einen breiteren Raum einnehmen würde?
Und wenn nur ein Effekt wäre, dass Bewusstsein geschaffen wird. Es kursieren einfach viele Vorurteile: Der Dialektsprecher ist einfältig, ist blöd, ist unsexy. Die Schule müsste vermitteln, dass Zweisprachigkeit, also die Fähigkeit, Dialekt und Standard zu sprechen, eine Repertoireerweiterung darstellt. Bei Ihrer Generation ist diese Zweisprachigkeit noch vorhanden, sie kann aber auch schnell verloren gehen. Beispiel Norddeutschland: Dort beherrschen die jungen Menschen den niederdeutschen Dialekt meist nur noch passiv.
Karl-Heinz Göttert vertritt in seinem aktuellen Buch „Alles außer Hochdeutsch“ die These, dass der „tiefe“ Dialekt verschwindet und durch regionale Ausgleichsmundarten ersetzt wird. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?
Man kann das als Chance sehen, dass der Dialekt an sich überlebt, allerdings in einer veränderten Form. Statt I hao koi Luscht sagt man heute I hab kei Luscht. Oder früher hat man gesagt Ä guets nuis. Heute sagt man Ä guets neis. Das ältere basisdialektale ui wird abgebaut, es hält sich aber eine Ausgleichsform, die großregionaler ist. Das ist ja immerhin was.
Diese Mischarten sind ja dann aber kein reiner, für eine Region typischer Dialekt mehr.
So einen Purismus darf man aber auch nicht erwarten. Reines Hochdeutsch, reinen Dialekt – das hat es ohnehin nie so richtig gegeben, vor allem nicht im Bereich des Hochdeutschen. Sobald Sprache gebraucht wird, ist das, was normativ festgelegt wird, oft nicht Realität. Auch nicht im Bereich des Basisdialekts.
Was würden Sie sich für die Zukunft des Dialekts wünschen?
Dass sich sein Status ändert. Der Reichtum des Dialekts müsste besser erkannt werden. Im Dialekt sind viele historische Informationen gespeichert, z. B. lautgeschichtliche Entwicklungen, die durch Unterscheidungen, die der Dialekt hat, dokumentiert werden und die im artifiziellen Standard nivelliert sind. Darüber hinaus unterstützen Wechsel zwischen Dialekt und Standard den Sprecher bei der grundsätzlichen Aufgabe, die soziale Situation zu definieren. Der Dialekt wird von Dialektologen als sogenannte Nähesprache bezeichnet, weil er sich insbesondere zum Ausdruck von sozialer Nähe und Vertrautheit eignet. Diese Möglichkeiten sind es, die Dialektsprechen so spannend machen.
Die Fragen stellten Simone Krimbacher und Franziska Bigelmaier.