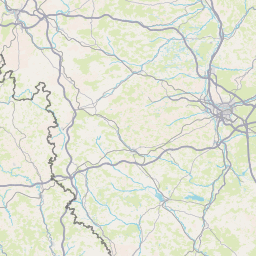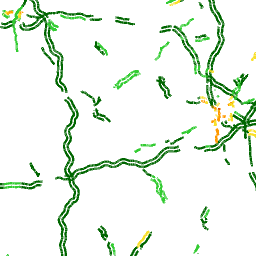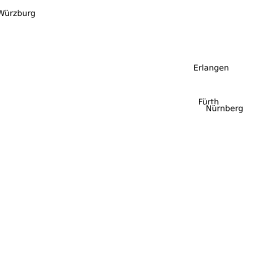Einmal wirklich sterben Traumaexpertin Dr. Ulrike Schmidt

Dr. Ulrike Schmidt, Oberärztin und Leiterin der Trauma-Ambulanz beim Max-Planck-Institut für Psychatrie in München, hat sich den Tatort: "Einmal wirklich sterben" vorab angesehen.
Im Tatort „Einmal wirklich sterben“ wird gezeigt, welche Auswirkungen ein traumatisierendes Erlebnis auf die junge Ella/Emma hat. Was versteht man unter einem „Trauma“ genau?
Dr. Ulrike Schmidt: Der Begriff ist griechischer Abstammung und bedeutet „Wunde“. Es gibt verschiedene Formen von Traumata, z.B. auch in der Chirurgie. Im psychiatrischen Kontext sprechen wir von einem Psychotrauma.
Es ist nicht nur ein stressiges, sondern ein ganz besonders schreckliches Erlebnis, das außerhalb des durchschnittlichen Erfahrungsspektrums liegt. Dazu gehört zum Beispiel, wie im Tatort „Einmal wirklich sterben“ zu sehen, wenn man mitbekommt, wie nahe stehende Personen ermordet werden oder wenn man selbst gefoltert, vergewaltigt, bedroht wird, einen schweren Unfall hat und der Partner dabei ums Leben kommt oder schlimme Erlebnisse im Krieg. Trennungen oder Scheidungen gehören übrigens nicht zu traumatischen Erlebnissen, wenngleich sie auch zu Depressionen oder anderen Krankheiten führen können.
Lässt sich ein solches Trauma, wie Ella/Emma es erlebt, je ganz überwinden?
Dr. Ulrike Schmidt: Menschen, die so etwas erlebt haben, haben danach immer eine besonders geprägte Persönlichkeit. Man kann so ein Trauma bewältigen, das bedeutet jedoch nicht, dass man es vergessen kann. Man kann aber lernen, damit zu leben, ohne davon beeinträchtigt zu werden und dann auch vollständig gesund werden. Was natürlich immer bleibt ist die Erinnerung und damit besondere Persönlichkeitsmerkmale. Es ist klar, dass sich ein Kind, das so etwas Schreckliches erlebt, anders entwickelt, als ein Kind, das vollständig geborgen aufwächst. Das muss aber nicht nur negative Auswirkungen haben, sondern kann sogar zu einer besonderen Persönlichkeitsstärke der Betroffenen führen. Es gibt dazu den wunderbaren Begriff des Posttraumatischen Wachstums. Viele PTBS-Patienten entwickeln eine besondere Sensibilität. Viele unserer Patienten hier sind sogar wesentlich schwerer traumatisiert, als Ella/Emma im Tatort und auch diesen Patienten kann man helfen, so dass sie zumindest eine deutliche Besserung der Symptomatik verspüren.
Können Sie ein Beispiel nennen für so eine besonders schlimme Form der Traumatisierung?
Dr. Ulrike Schmidt: Das Schlagwort hier ist die rituelle Gewalt. Wenn Vergewaltigungen, Missbrauch und Schläge über Jahre hinweg praktiziert werden, verändert sich die Persönlichkeit umso mehr, weil nicht mehr genügend Zeit zwischen den Ereignissen bleibt, um sich zu erholen. Aber auch Menschen, die so ein Martyrium durchleiden mussten, kann man durch psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung gut helfen.
Was lernt der Zuschauer in diesem Tatort genau über das Thema Traumabewältigung?
Dr. Ulrike Schmidt: Der Zuschauer lernt etwas über die Symptome, die Zustände und Auswirkungen einer Traumafolgestörung. Der Film transportiert das Thema besonders gut, da er sich auch auf die Gefühlsebene begibt. Ein Vortrag z.B. könnte letzteres nie leisten. Auch finde ich wichtig, dass man sieht, dass von einer psychischen Erkrankung eines Menschen sein soziales Umfeld genauso betroffen sein kann. Es kann uns allen passieren, dass wir jemanden kennenlernen, der so etwas Schlimmes erlebt hat, oder dass wir gar selbst ein traumatisches Erlebnis durchleiden. Man muss allerdings keine Angst vor traumatisierten Patienten haben, denn sie handeln oftmals sogar besonders einfühlsam und es widerstrebt ihnen zutiefst, anderen Leid zuzufügen.
Wünschen Sie sich mehr Öffentlichkeit für das Thema?
Dr. Ulrike Schmidt: Ja! Auf jeden Fall. Zum Glück thematisieren die Medien PTBS immer mehr und ich sehe dabei große Erfolge. Die Scheu vor dem Thema wird genommen, was bewirkt, dass sich immer mehr Menschen frühzeitig melden und wir ihnen helfen können. Mir ist wichtig, dass unsere Gesellschaft einen selbstverständlicheren Umgang mit psychischen Krankheiten findet. Das Gehirn ist genauso ein Organ wie alle anderen und kann genauso krank werden. Für einen Beinbruch oder einen Gallenstein schämen wir uns auch nicht. Je früher die Menschen zum Arzt gehen, umso besser. Es gibt immer wieder Fälle, bei denen sich Menschen umbringen, weil sie aus Scham nicht zum Psychiater gegangen sind. Medien spielen daher eine große, verantwortungsvolle Rolle in der Aufklärung über psychische Krankheiten. Für uns sollte es selbstverständlich werden, über unsere psychischen Belastungen, Probleme oder Symptome zu sprechen - so selbstverständlich, wie über eine Erkältung.
Welche „Erste Hilfe“-Maßnahmen gibt es bei einer akuten Traumatisierung?
Dr. Ulrike Schmidt: In einer akuten Situation ist das Allerwichtigste, Patienten abzulenken und nicht über das Erlebte zu sprechen. Die biologische Begründung dafür ist, dass sich die Erinnerungen in eine Struktur im Gehirn, in den Hippocampus, eingraben und PTBS fördern kann, wenn man sofort nach dem Erlebnis alles wieder hervorholt. Daher erstmal: Ablenkung, Ablenkung, Ablenkung. Im Fall des kleinen Quirin zum Beispiel wäre eine Gruppe mit anderen Kindern am besten, damit so schnell wie möglich Normalität einkehren kann. Sehr wichtig ist auch das Etablieren einer neuen Bezugsperson. Menschliche Wärme, Nähe und Geborgenheit sind essentiell für alle Kinder, besonders wichtig aber für traumatisierte. Idealerweise begleitet diese neue Bezugsperson das Kind dann mindestens bis ins frühe Erwachsenenalter.
Wie sehen längerfristige Therapien für PTBS-Patienten wie Ella/Emma aus?
Dr. Ulrike Schmidt: Bei erwachsenen Patienten gibt es mehrere Therapiephasen. Erstmal wird auch hier nicht über das Ereignis gesprochen, sondern es werden verschiedene Methoden an Alltagsproblemen geübt. Zum Beispiel, wie man seine Gedanken und Gefühle steuern kann oder wie man verhindern kann, dass man in die Dissoziation/Flashbacks kommt. Wenn der Patient das Rüstzeug dafür hat, kann man sich im Detail den traumatischen Erlebnissen widmen. Dann geht man immer und immer wieder die schrecklichsten Ereignisse durch, bis diese Bilder nicht mehr hochkommen und der Patient sich emotional davon distanzieren kann und merkt, dass das Erlebte abgeschlossen ist, also in der Vergangenheit liegt. Das ist das Prinzip der Expositionstherapie. Wenn diese Phase durchlaufen ist, sind die Symptome besser, jedoch hat sich die Persönlichkeit meist verändert. Der nächste Schritt ist dann, zu klären, was diese Veränderung für den Patienten bedeutet, wie er in der Zukunft damit umgeht und was seine Pläne sind.
Wie können Angehörige/Freunde in so einer Situation unterstützen?
Dr. Ulrike Schmidt: Das Beste ist in so einem Fall, emotionale Wärme und Sicherheit zu bieten, für Ablenkung zu sorgen und die Patienten zu Unternehmungen zu motivieren. Wichtig ist vor allem die Hilfe und der Begleitschritt zur Therapie. Ein Mensch mit einer derartigen traumatischen Belastung benötigt vier Dinge am allermeisten: Ein festes soziales Umfeld, eine klare Tagesstruktur, eine Aufgabe und natürlich eine Behandlung. Am besten ist in so einem Fall ein Gruppenkontext, in dem man sich aufgehoben fühlt.
Zitat aus dem Film zu Daniel Ruppert: "Warum erschießt jemand, der wirtschaftliche Probleme hat, seine Familie gleich mit?"
"Batic: Damit er niemanden hat, vor dem er sich schämen muss". Ist das realistisch?
Dr. Ulrike Schmidt: Schamgefühle sind wohl ein eher seltenes Motiv für einen Mord, aber durchaus denkbar. Menschen, die aus solchem Motiv heraus ihre Liebsten umbringen, haben meist große Defizite im Umgang mit ihren Mitmenschen und mit hoher Wahrscheinlichkeit eine heftige Persönlichkeitsstörung. Gerade weil er emotionale Defizite hat, ist es durchaus realistisch, dass Daniel Ruppert sich später eine neue Familie aufbaut, weil er eine besondere Sehnsucht nach Wärme und Nähe verspürt. Ob er dabei jedoch tatsächliche Wärme und Liebe fühlen kann, bleibt dahingestellt.
Wie häufig sind Suizid-Gedanken bei Patienten mit PTBS?
Dr. Ulrike Schmidt: Suizidgedanken kommen besonders häufig bei Patienten vor, die in der Kindheit traumatisiert wurden, weil dabei oft die Persönlichkeitsentwicklung deutlich beeinträchtigt wird. So fällt es zum Beispiel schwer, ein Urvertrauen und eine Urfreude aufzubauen. Deutlich seltener kommen sie bei Erwachsenentraumatisierung vor. Auf meiner Station sind überwiegend komplex traumatisierte Menschen, die im Kinder- und Jungendalter traumatisiert worden sind, wodurch, gerade zu Behandlungsbeginn und während der Expositionsphase, Suizidwünsche ein großes Thema für die Patienten sind. Mit fortschreitender Behandlung nimmt die Suizidalität jedoch ab und manche Patienten wundern sich nach der Therapie, warum sie überhaupt solche Gedanken hatten.
Wie geht man als Therapeut damit um und wie kann man diese Suizidgedanken frühzeitig bemerken?
Dr. Ulrike Schmidt: Ein Hinweis auf eine eventuelle Gefährdung ist eine starke, länger anhaltende Depression und eine Vernachlässigung von Aktivitäten, die den Betroffenen sonst immer wichtig waren - das kann auch Angehörigen auffallen. Die meisten Patienten geben bei Nachfragen auch zu, dass sie Suizidgedanken haben. Am schwierigsten ist es bei den Patienten, die schon längst beschlossen haben, sich etwas anzutun und es nicht zugeben. Das ist dann eher eine Kunst als eine Wissenschaft, das zu bemerken. Da können dann auch Fehleinschätzungen passieren. Aber in der Regel sprechen die Patienten darüber, man muss halt nachhaltig und genau danach fragen. Das kann man auch indirekt tun, wenn man nach Plänen für die Zukunft fragt und danach, was Spaß macht oder am Leben hält.
Wie werden suizidgefährdete Patienten behandelt?
Dr. Ulrike Schmidt: Wenn wir merken, dass eine Gefährdung besteht, behalten wir die Patienten hier in der Station und geben, in manchen Fällen zusätzlich zur Psychotherapie, entsprechende Medikamente. Im Zweifelsfall, also wenn ein Patient nicht bleiben möchte, sondern krankheitsbedingt lieber sterben, kommt ein Richter, der entscheidet, ob man einen Patienten auf Station behalten und behandeln darf. Eine Psychotherapie gegen den Willen eines Patienten zu machen funktioniert jedoch nicht – daher ist es wichtig, Patienten vor Behandlungsbeginn von der Sinnhaftigkeit der Therapie zu überzeugen und sie dafür zu motivieren.